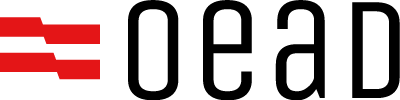Wir wollen ganz an den Anfang Ihrer Karriere gehen: Erinnern Sie sich noch, warum Sie sich entschieden haben, Germanistik zu studieren?
Oksana: Ja, da fange ich noch vor der Volksschule an. Ich bin im Stadtzentrum von Lviv/Lemberg aufgewachsen und im Westen der Ukraine hat das Deutsche schon seit k. u. k.-Zeiten Tradition gehabt, obwohl zu sowjetischen Zeiten Fremdsprachen nicht wichtig waren. Das Russische war die Sprache, die alle lernen sollten. In der Schule hatten die Kinder vielleicht eine Stunde pro Woche Fremdsprachenunterricht, aber man brauchte doch Übersetzer/innen und Sprachlehrer/innen und so hat es Schulen mit erweitertem Fremdsprachenunterricht gegeben. In Lviv gab es zwei solcher Schulen mit erweitertem Deutschunterricht und da meine Eltern bemerkt haben, dass ich ein gutes Gedächtnis habe, schickten sie mich in eine Schule mit erweitertem Fremdsprachenunterricht. Es ist übrigens die älteste Schule in der Ukraine, jetzt das Lyceum Nr. 8 in Lviv. Das ist die Schule, die auch der polnische Schriftsteller Stanislaw Lem besucht hat. Der Schriftsteller wohnte zwei Straßen weiter von der Straße, wo ich aufgewachsen bin und wir gingen auch denselben Weg zur Schule, den Lem in seinem Buch „Das hohe Schloss“ beschrieben hat.
Schüleraustausch in der DDR
Ich wollte immer Sängerin werden. Ich spielte 8 Jahre lang ein ukrainisches Volksinstrument, die Bandura. Das hat der Kosake im Türkenschanzpark am Schoß. Meine Eltern waren nicht ganz begeistert. Sie haben mich irgendwie Richtung deutsche Sprache gedrängt, ich habe mich noch ein bisschen gesträubt. Aber im Jahr 1986, noch zu sowjetischen und DDR-Zeiten, kam ich mit einem Schüleraustausch in die DDR. Und diese Reise hat alles verändert! Es ist so lustig, ich habe mit einem Kollegen bei uns am Germanistikinstitut gesprochen, er war im selben Jahr als österreichischer Austauschschüler in der DDR. Er sagte, dass es trist, so grau und so schrecklich war. Und ich habe ihm gesagt: „Ja, stell dir einmal vor, wie das Leben in der Sowjetunion war!“ Ich war eine sowjetische Schülerin in der DDR und für mich war das der wilde Westen, es war so bunt. Ich kann mich erinnern, ich war beim Alexanderplatz und da standen Punks. Ich hatte noch nie Punks gesehen, in der Sowjetunion waren sie verboten. Ich habe zweimal geblümte Schuhe in einer größeren Größe als ich gebraucht habe, gekauft, weil es meine Größe nicht gegeben hat. Bei uns war alles grau und schwarz. Wir standen eines Abends auch am Alexanderturm und ich schaute über das spärlich beleuchtete Ostberlin und das neonfarbene und blitzende Westberlin. Bis dahin hatte ich alles geglaubt, was in der Schule gesagt wurde: Kapitalismus ist Menschenausbeutung, ein grausames System und ein tristes Leben. Und ich dachte, es kann ja nicht so schlimm sein, wenn es so bunt ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde gerne wieder in die DDR kommen.
Ich kam zurück und hatte einen Plan: Ich wollte reisen, aber es war schwer, zu reisen. Innerhalb der Sowjetunion schon, aber nicht in die anderen sozialistischen Länder. Die Leute aus diesen Ländern wiederum konnten interessanterweise schon reisen, das haben wir auch bei Freunden aus Polen oder Tschechien beim OeAD-Austausch bemerkt. Aber ich habe gehört – meine Mutter hat es mir vielleicht absichtlich erzählt, damit ich darauf höre – der Sohn einer Bekannten ist Übersetzer/Dolmetscher vom Deutschen, er ist Reiseführer und fährt mit Reisegruppen in die DDR und die damalige Tschechoslowakei. Und da habe ich mir gedacht, ich werde auch Deutsch studieren, um reisen zu können.
Mein Mann Tymofiy und ich haben zusammen studiert. In der Ukraine ist das wie in den Fachhochschulen, es gibt fixe Gruppen. Wir haben uns am Anfang unseres Studiums kennengelernt. In der Sowjetunion hat das Studium nicht mit Einführungsvorlesungen begonnen, sondern mit der harten Arbeit auf einer Kolchose bei Brody, wo Joseph Roth geboren ist. Wir haben in einem Konservierungswerk gearbeitet und Tomaten sortiert, Äpfel für Apfelmus geschnitten usw. Und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben 1988 zu studieren begonnen, kurz vor dem Zerfall. Wir hatten noch im ersten Studienjahr Fächer wie „Die Geschichte der kommunistischen Partei“, obwohl überall in den Zeitungen schon die Wahrheit stand. Aber der Hochschullehrer hat noch nach alten Richtlinien unterrichtet, es war eine spannende Zeit. Wir konnten dann schon im Laufe des Studiums nach dem Zerfall ungehindert reisen.
Warum haben Sie sich für Österreich entschieden?
Mein Uropa hat lange gelebt und ich war 14, als er gestorben ist. Als ich ungefähr 13 war, hat er mir vom 1. Weltkrieg erzählt. Er hatte Glück, er war kurzsichtig und man hat ihn nicht an die Front geschickt wie den anderen Uropa, den ich nicht erlebt habe. Er sagte: „Ich hab Glück gehabt. Dadurch dass ich nicht so gut gesehen habe, hab ich in Wien auf Gefangene aufgepasst.“ Und ich habe ihn gar nicht gefragt über Wien, denn das war für mich so etwas wie der Mars. Jetzt tut es mir leid, dass ich nicht gefragt habe, aber ich habe ihn Folgendes gefragt: „Opa, ist Wien viel weiter weg als Moskau?“ Und er sagte: „Nein, Wien ist zweimal näher als Moskau!“ und das hat mich umgehauen. Wie kann ein kapitalistischer Staat – wir waren in diesem Diskurs: Kapitalismus = Feind – wie kann ein feindliches kapitalistisches Land näher sein als „unsere Hauptstadt Moskau“. In ein kapitalistisches Land zu kommen, war unwahrscheinlich. Wien, das wird nicht gehen, und ausgerechnet da sind wir jetzt gelandet!
Das erste österreichische Wort und Erdäpfelknödel
Am Ende des letzten Studienjahres im Jahr 1992 kam zu uns als erster westlicher Professor Peter Wiesinger, der bekannte Germanist, und hielt einen Vortrag über das österreichische Deutsch. Dieser Vortrag hat mich sehr geprägt. Ich saß da und dachte, wie konnte das sein, dass ich das nicht verstehen kann, dass das österreichische Deutsch so viel anders ist als das, was ich so lange in der Schule und an der Uni gelernt habe. Ich kann mich noch an das erste Wort, „Erdäpfel“, erinnern. Ich fand das so poetisch. Er hat uns auch am Beispiel von kulinarischen Rezepten das österreichische Deutsch erklärt. Die Wörter Germ, Erdäpfel. Er hat uns ein Rezept für Erdäpfelknödel gegeben und ich habe es am selben Abend zuhause gekocht und meinen Eltern hat es sehr gut geschmeckt. Papa hat gesagt, dass meine Uroma auch genau solche Knödel in seiner Kindheit gekocht hat und das ist verständlich, weil die Oma das Kochen noch zu k.u.k.-Zeiten gelernt hat.
Der OeAD in der Ukraine
1992 eröffnete nicht nur die Österreich-Bibliothek in Lviv, sondern auch die Außenstelle des österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts. Das war die Stelle, die die ersten OeAD-Stipendien in die ukrainische akademische Welt gebracht hat.
Das österreichische Deutsch hat mich so fasziniert. Am Ende des Studiums wusste ich, dass wir schwierige Zeiten hatten. Kaum jemand hat Fremdsprachen gesprochen. Leute mit Fremdsprachenkenntnissen waren Gold wert und es gab viele Angebote aus der Wirtschaft. Man hat uns (Anm.: Oksana und ihrem Mann) dann vorgeschlagen, das Dissertationsstudium zu machen. Ich war hin- und hergerissen. Ich wollte reisen und übersetzen, aber meine Eltern haben mir sehr ausdrücklich gesagt: „Nein, wenn man dir das Dissertationsstudium anbietet, mach es. Es wird nicht immer so schwierige Zeiten geben, einmal wird es gut sein, im akademischen Bereich zu arbeiten.“ Ab 1993 habe ich dann begonnen, selbst in dieser Außenstelle zu arbeiten und habe dann drei Jahre bis zur Schließung 1996 dort gearbeitet und viele, viele OeAD-Stipendiatinnen und -Stipendiaten betreut. Ich fühle mich irgendwie zugehörig zu ihrem Team.
Wie Oksana zum Schimpfen kam
Weil mich das österreichische Deutsch so fasziniert hat, habe ich mich dann 1994 für ein OeAD-Kurzstipendium für das Wienerische beworben und wollte in Österreich auch ein Dissertationsthema finden. Das Thema sollte lebendig und wenig erforscht sein. Bei einer Exkursion in die Wachau saßen wir dann natürlich beim Heurigen. Ich hatte gesehen, dass das Wienerische relativ gut erforscht ist und war ein bisschen ratlos. Die zwei Monate waren schon fast vorbei und ich hatte noch kein Thema gefunden. So saßen wir also beim Heurigen und haben uns über unsere Ergebnisse der Forschungen in Österreich ausgetauscht. Ich habe gesagt, dass ich noch immer nicht weiß, was ich erforschen soll. Ich hatte jetzt so viele Wörterbücher durchgeschaut, ich kannte mich schon so gut im Wienerischen aus. Es gibt so viele Schimpfwörter. Und dann sagte jemand: „Ja, dann nimm halt die Schimpfwörter!“ Und ich habe gesagt, ja, warum nicht! Alle haben gelacht und ich bin dann wirklich in die Ukraine zurückgefahren und zu meinem Doktorvater gegangen, der damals noch Dekan aus sowjetischen Zeiten und ein strenger, zugeknöpfter Mann war. Ich habe gedacht, oje, was wird der sagen. Aber dieser „Wind of change“ hat ihn so beeinflusst, dass er gesagt hat „Ja, warum nicht! Jetzt ist alles offen, alles kann erforscht werden. Aber Oksana, Sie brauchen 2.000 Beispiele. Die Schimpfwörter können in verschiedenen Kontexten sein – ein Schimpfwort kann ja auch ein Kosewort sein – Sie brauchen aber mindestens 2.000 Belege. Und wo Sie diese finden, weiß ich nicht.“
Ich habe dann von Tymofiy erfahren, dass es die Österreich-Bibliothek gibt und habe dort, nachdem ich meine Chefin und andere Freunde aus Österreich gefragt habe, wo wer schimpft, zielgerichtet gesucht und ganze Passagen durchgeschaut und viel Zeit dort verbracht. Man hatte mir gesagt, dass ich bei Thomas Bernhard, Werner Schwab, Elfriede Jelinek oder H.C. Artmann suchen sollte. Mein Material habe ich also dort in der Österreich-Bibliothek gesammelt, aber auch bei weiteren Kurzstipendien in Österreich bis 2001. Insgesamt hatte ich dreimal Kurzstipendien des OeAD.
Welchen Einfluss hatte der Stipendienaufenthalt auf Ihre persönliche und berufliche Entwicklung?
Die Stipendien haben mich sehr beeinflusst. Es gibt auch eine andere längerfristige Wirkung der OeAD-Stipendien, von der Sie vielleicht gar nichts ahnen. Zum Beispiel haben wir hier so viele interessante Stipendiatinnen und Stipendiaten aus anderen Ländern kennengelernt, auch aus unseren Heimatstädten in der Ukraine. Anfang 2000 kam mir die Idee, eine Vortragsreihe in Lviv zu organisieren und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzuladen, die in der Nähe wohnen und problemlos kommen können. Es gibt so viele Leute, die zu interessanten Themen der österreichischen Kultur, Geschichte, ukrainisch-österreichischen Beziehungen forschen. Viele bekannte Historiker/innen, Naturwissenschaftler/innen und Fachleute sind gekommen und ich habe es zusammen mit Andreas Wenninger vom österreichischen Kooperationsbüro in einem Kunstviertel mitten in Lviv organisiert. Es hat 2004–2006 und 2008–2012 stattgefunden. Dabei erschienen zwei Bände, „Die Reise nach Europa“ und „Die neue Reise nach Europa“. Als Elfriede Jelinek den Nobelpreis erhielt, hat auch Tymofiy zwei Vorträge gehalten, die sehr gut besucht waren.
Wenn ich jetzt so daran denke, waren über 70 % der Teilnehmenden OeAD-Stipendiatinnen und -Stipendiaten. Es geht bis ins private Leben hinein: Den Taufpaten unseres älteren Sohns haben wir auch als OeAD-Stipendiat kennengelernt und es bei einem Glas Punsch am Rathausplatz besiegelt. Er ist Historiker.
Die Wiener Vorlesungen als Motivation
Mein Buch ist aus den Wiener Vorlesungen hervorgegangen. Damals, zu meiner Stipendienzeit, war ein unerforschtes Thema natürlich eine Herausforderung und bei der Forschungsarbeit doch manchmal ziemlich kompliziert. Ich kann mich erinnern, es war Herbst oder Winter, so tristes Wetter, und ich kam verfroren von der Bibliothek und sah die Plakate von den Wiener Vorlesungen. Ich dachte damals, dass ich lieber in die Wirtschaft gehe. Meine Eltern hatten kein Recht, für mich zu entscheiden. Die Ukraine war seit drei Jahren unabhängig und es waren noch immer so schwierige Zeiten, ich wollte die Wissenschaft schmeißen und Dolmetscherin werden. Dann habe ich die Wiener Vorlesungen gesehen, eine Wissenschaftlerin, und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich weiterforschen und vielleicht werde auch ich zu einer Wiener Vorlesung eingeladen. 25 Jahre sind dann vergangen und ich habe eine Einladung bekommen!
Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit dem Schimpfen. Inzwischen sind Sie auch Mutter von zwei Söhnen. Helfen Ihnen Ihre Söhne, immer auf dem letzten Stand zu sein und die neuesten Entwicklungen in ihrem Forschungsgebiet mitzubekommen?
Als wir vor 10 Jahren gekommen sind, da habe ich mich noch nicht mit der Jugendsprache ausgekannt. Der große Sohn hat mir schon das eine oder andere jugendsprachliche Wort beigebracht, insbesondere habe ich damals diese rituellen Mutterbeleidigungen entdeckt. Aber mit dem Kleinen, der ist jetzt 14, der bringt mir irgendwie nichts bei. Ich bin seit 2015 Wissenschaftsbotschafterin und bin ungefähr dreimal pro Semester in Schulen, wo ich Workshops mit Kindern durchführe. Da hatte ich für eineinhalb Jahre ein Wissenschaftskommunikationsprogramm vom FWF und war an zwölf Wiener Schulen. Ich habe praktisch mein ganzes Belegmaterial an jugendsprachlichen Schimpfwörtern selbst durch Umfragen gesammelt.
Aber es gibt schon Bezüge zu den Kindern, ich glaube ich nehme ihnen den Reiz des Verbotenen. Sie können mich alles fragen, insbesondere was die deutschen Schimpfwörter betrifft. Ich kann ohne Hemmungen die Schlimmsten aussprechen. Vielen geht es so und ich habe da eine Erklärung, warum wir muttersprachliche Schimpfwörter oft als stärker empfinden. In der Muttersprache lernen wir oft zuerst diese emotionale Bedeutung kennen. Noch ohne zu wissen, was das Wort bedeutet, sind die Kinder konfrontiert mit der starken emotionalen Bedeutung. Das Kind schnappt das auf und kommt nach Hause, sagt das und sieht die Eltern: „Das darfst du nicht sagen!“ Das prägt dann unsere Wahrnehmung und die Wahrnehmung von Schimpfwörtern.
Beim Ukrainischen war das anders. Warum sage ich war, denn dann ist der Krieg gekommen. Wenn ich Krieg sage, dann denke ich an 2014. Und ich kann mich erinnern, einen Monat nachdem die Krym besetzt wurde, entstand ein Anti-Putin-Sprechgesang, den ich auch in meinem Buch beschreibe. Im Ukrainischen ist das ein aus dem Russischen entlehntes Wort. Es klingt schrecklich. Es klang für mich bis 2014 so schrecklich, das hätte ich nicht in den Mund genommen. Das Wort klingt für mich immer noch ziemlich schlimm, aber die Fans von zwei Fußballmannschaften in der Ukraine haben sich vereint und vor dem Spiel diesen Sprechgesang gesungen und das ist zum Internet-Meme geworden, auf T-Shirts gedruckt worden und zum Motto des Widerstands geworden. Ähnlich wie jetzt der breite Krieg, wie man das jetzt nennt, ausgebrochen ist. Da war dieser Spruch, als ein russisches Militärschiff zur Schlangeninsel gekommen ist und die Soldaten zur Aufgabe aufgefordert hat. Das war die spontane Reaktion des ukrainischen Soldaten. Eine aggressive Aufforderung, um negative Emotionen abzureagieren. In den nächsten Tagen kamen zusätzliche Funktionen wie die empathische, kooperative Funktion: Wir halten zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Da spielt auch Humor eine wichtige Rolle.
Daran sehen wir, wie ein Schimpfwort an Stärke verliert hinsichtlich der Taten, die diese Person, die das Schimpfwort bezeichnet, verübt. Für mich klingt jetzt das Wort Putin fast schlimmer als ein echtes Schimpfwort. Als Putin 2014 nach Wien kam, übrigens sein erster Besuch im Westen nach der Okkupation, wurde er mit rotem Teppich empfangen, was uns sehr traurig gemacht hat. Da waren tausende Ukrainerinnen und Ukrainer bei diesen Protesten. Da konnte ich dann tagelang nicht reden, weil ich so laut geschrien habe. Meine Kinder waren dabei. Noch einige Monate davor hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich so ein brutales Wort in Anwesenheit meiner Kinder sagen würde. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie ein Schimpfwort verblasst angesichts der Grausamkeit einer Person, die es bezeichnet.
Die Forschungsthemen gehen nicht aus
Vor 10 Jahren hat eine Kollegin am Germanistikinstitut gesagt, dass ich schon seit 20 Jahren zu diesem Thema forsche, immer verbale Aggression, und immer etwas finde, aber vielleicht gehen die Themen bald aus. Aber dann kam die Jugendsprache, dann kam Sprache und Corona, da hat auch verbale Aggression oder expressive Lexik eine wichtige Rolle gespielt. Parallel arbeite ich jetzt an zwei Beiträgen: „Sprache und Corona“ und „Sprache und Krieg“. Dann kam die Wissenschaftskommunikation. Nach ungefähr 25 Jahren habe ich gespürt, dass ich jetzt irgendeinen praktischen Nutzen sehen will. Das war dann das Wissenschaftskommunikationsprogramm, und als ich in den Schulen war, habe ich mit den Lehrerinnen und Lehrern gesprochen und viele haben gesagt, dass alle diese Inhalte so interessant sind, die ich mit Kindern behandle. Es wäre für sie als Studierende an der Uni gut gewesen, wenn sie so einen Lehrgang gehabt hätten, wo sie auf die Herausforderungen im schulischen Alltag vorbereitet worden wären.
Jetzt halte ich seit drei Semestern einen Lehrgang am Institut für LehrerInnenbildung der Universität Wien für Masterstudierende. Die interkulturellen Besonderheiten, das spielt eine sehr große Rolle, angefangen von den Schimpfkulturen bis zu den Funktionen, die dieses Schimpfen erfüllt. In vielen Sprachen gibt es zum Beispiel Funktionen, die es im Deutschen nicht gibt, wie der pausenfüllende Gebrauch. Das kommt im Wienerischen dem „Oida“ gleich.
Sie sind ja auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Young Science in Verbindung und agieren als Young Science-Botschafterin
Da komme ich in die Klasse und sage: „Ich heiße Oksana usw., ich bin von der Uni, ich bin Germanistin.“ Und manche Kinder lachen und sagen: „Germanistin und redet mit einem Akzent.“ Manche Lehrerinnen haben sich bei mir entschuldigt, weil die Kinder, vielleicht weil sie mit deutschem Fernsehen aufwachsen, das nicht gewohnt sind. Aber dann wiederum sagen viele Lehrerinnen, dass es sehr wichtig war. Viele Kinder mit Migrationshintergrund haben noch nie eine Frau mit Migrationshintergrund gesehen, die es bis zur Uni geschafft hat. Die fühlten sich gleich so beflügelt, dass es möglich ist mit Akzent.
Die Kinder stehen vor der Berufswahl und sie fragen mich auch immer, warum ich Deutsch studiert habe und Sprachwissenschaftlerin geworden bin und ob man da viel Geld verdienen kann. Sie finden es immer besonders spannend, wenn ich sage, dass es in der Sowjetunion unmöglich war zu reisen. Sie sagen dann, das Reiseverbot, das ist ja wie in Nordkorea! Ja, das ist vergleichbar. Für mich war Deutsch der Schlüssel zur Freiheit.
Wenn Sie als Young Science-Botschafterin in den Schulen sind und mit den Schülerinnen und Schülern reden, verstehen diese sich dann selbst besser oder ändern sie ihr Schimpfverhalten?
Ja, das hoffe ich. Ich stehe in Kontakt mit Lehrenden. Die bestätigen mir auch, dass die Kinder durch meinen Besuch sehr beeinflusst waren. Zum Beispiel das allgegenwärtige „behindert“. Ich komme in die Schule und höre „Das ist behindert“, „Du bist behindert“, „Aber Frau Professor, sie ist ja nicht beleidigt, wenn ich das sage, das sagen wir so untereinander“. Und ich sage dann: „Aber wenn ihr das sagt, ist es eine indirekte Beleidigung für Leute da draußen, die wirklich in ihren physischen und psychischen Eigenschaften eingeschränkt sind.“ Und wenn den Kindern das bewusst wird, sie denken davor nicht daran – da sind wir bei der emotiven Bedeutung, die steht im Vordergrund bei den Schimpfwörtern; die wirkliche Bedeutung tritt in den Hintergrund – dann entscheiden sie sich oft, diese Wörter nicht zu gebrauchen.
Eine Lehrerin hat mir erzählt, dass sie ein Sparschwein aufgestellt haben und die Kinder für jedes „behindert“ 50 Cent zahlen müssen. Es ist Gewohnheitssache, es passiert nicht von heute auf morgen. Ich versuche den Kindern beizubringen, dass es möglich ist, an ihrer Sprache zu arbeiten und es von ihnen abhängt und man sich auch bewusst bestimmte Wörter abgewöhnen kann. In der Volksschule kann man noch sehr gut mit neutralen Wörtern schimpfen. Ich versuche ihnen beizubringen, dass negative Emotionen normal sind. Diese müssen nicht mit vulgären Schimpfwörtern ausgedrückt werden, z.B. kennen alle „Krawuzi Kapuzi“. Im Kindergarten sehen sie durch die Geschichte der Kokosnuss viel Geschimpfe wie „Du fliegende Tomate“. Die Kinder experimentieren dann sehr gern mit diesen neutralen Wörtern und lernen Emotionen auszudrücken. Wir lernen immer, dass es gut ist, konstruktiv zu reden, wie „Sei ruhig, ich möchte noch die Hausübung fertigschreiben“. Alles im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Man soll eigene Bedürfnisse erkennen und diese dann konstruktiv äußern.
Haben Sie das Gefühl, die verbale Aggression ist durch den Krieg oder Covid gestiegen?
Bei meinen Projekten habe ich oft Ratschläge von Gutachtern bekommen, Reaktanz zu vermeiden, sodass die Kinder sich nicht bekräftigt fühlen, nach einem Projekt vielleicht noch mehr zu schimpfen. Das trifft überhaupt nicht zu, weil der Reiz des Schimpfens ist, gegen das Verbotene zu verstoßen. Wenn ich in die Klasse komme und sage, wir reden jetzt über das Schimpfen, dann nehme ich dieses Verbotene weg und auch die Lehrenden sagen, dass die Kinder behutsamer miteinander umgehen, weil auch viel von Empathie die Rede ist. Wir sprechen konkrete Situationen an, wie zum Beispiel freche Erstklässler/innen, die sie beschimpfen. Dann denken wir darüber nach, warum sie schimpfen, wie sie sich gefühlt haben, als sie nach der Volksschule in die neue Schule gekommen sind. Sie sagen dann, dass sie unsicher waren, ob sie Freunde finden usw. Die Erstklässler haben also einfach Angst, und aus Angst wird geschimpft. Das ist eine der Ursachen. Oder als Selbstdarstellung: Ich schimpfe, um zu zeigen, dass ich stark bin und kein schwaches Mädchen.
Wenn man als Außenstehender in die Schule kommt und die schlimmsten Schimpfwörter hört, entsteht der Eindruck, dass mehr geschimpft wird. Aber die Lehrenden in der Schule bestätigen das nicht. Wenn man sich den Wortschatz anschaut, so gibt es schon viele Schimpfwörter, aber man kann nicht jeden Gebrauch als verbale Gewalt betrachten. Es sind nämlich sehr oft fiktive Formen wie scherzhaftes Schimpfen, um im Freundeskreis zu zeigen, dass die Freundschaft so eng ist und man diese Wortspiele verkraften kann. Oder als Selbstdarstellung: Ich bin cool! All das zählt zu diesen fiktiven Formen. Aber andererseits gibt es auch Formen, mit denen verbale Gewalt ausgeübt werden kann, die ohne Schimpfwörter auskommen. Zum Beispiel habe ich beobachtet, dass die Nationalschelten, die noch vor 10, 15 Jahren in meinem ersten Projekt häufig vorkamen, abgenommen haben. Jetzt wird das von den Kindern gar nicht erwähnt. Einerseits könnte das ein gutes Zeichen für kulturelle Sensibilisierung sein. Andererseits müsste erforscht werden, ob das nicht andere Formen angenommen hat, mit neutralen Aussagen wie: „Du gehörst nicht zu uns, du bist nicht von hier.“
Verbale Aggression in sozialen Medien
Was es Neues gibt im Vergleich zu vor 15 Jahren ist die verbale Aggression in sozialen Medien.
Neue Formen wie Gewalt in sozialen Medien hat es vor 30 Jahren nicht gegeben, diese Gewalt fand aber – wenn auch nicht in diesem Ausmaß – im realen Leben statt. Auch wenn früher nicht von Mobbing die Rede war, hat es diese Form psychischer bzw. verbaler Gewalt gegeben, sie hatte nur keinen Namen. Aber hier sehen wir, wie die Sprache Bewusstsein für bestimmte Phänomene schafft. Ich bin einmal von einer Journalistin gefragt worden, ob ich einmal gemobbt worden bin. Zuerst habe ich nein gesagt, aber dann habe ich mich an meine sowjetische Kindheit Ende der 70er Jahre erinnert und an ein Mädchen, dessen Mutter Parteivorsitzende in der Schule war und die geglaubt hat, sie sei etwas Besseres. Wir sollten ihre Schultasche tragen und ich habe mich als Einzige geweigert, da bin ich jetzt noch stolz darauf. Sie hat dann alle gegen mich gehetzt und erst nach zwei, drei Tagen verweigerte auch ein anderes Mädchen das Tragen der Tasche. Das war der Anfang einer sehr langen und schönen Freundschaft. Das erkläre ich auch den Kindern: Trau dich, wenn du einen Fall von psychischer, physischer oder verbaler Gewalt siehst. Trau dich, auf die Seite dieser Person zu treten. Du kannst sehr wohl als Einzelperson viel ändern. Viele sagen: „Was kann ich machen?“ Das ist das, was wir in Russland sehen, diese Passivität. Viele schweigen, viele haben Angst. Die Russen haben Angst vor den Knüppeln der Polizisten, während Ukrainerinnen und Ukrainer in Cherson protestierten, als die Panzer durch die Stadt fuhren.
Das Schimpfen ist in Russland auch heute wieder verboten. Dieses erste Gesetz vom 1. Juli 2014 – d.h. als die russische Aggression im Osten der Ukraine eskalierte, kam plötzlich ein Gesetz – „Verbot von Schimpfwörtern in Massenmedien, Literatur, Theaterstücken“. Viele haben sich gefragt, was das soll. Und ich habe es auf meine Art und Weise interpretiert, nämlich dass Putin durch das Hervorheben dieser verbalen Aggression die physische Aggression verschleiern möchte. Als ich am 24. Februar, als der Krieg ausbrach, auf Facebook gegangen bin, habe ich nur noch Verwünschungen gesehen. Eine Verwünschung ist im Deutschen kein sehr häufiger Sprechakt, wenn schon dann scherzhaft im Wienerischen: „Du sollst Krätze am Hintern bekommen und zu kurze Hände zum Kratzen.“ Das sind übrigens Lehnübersetzungen aus dem Jiddischen. Das Jiddische ist bekannt für diese zweiteiligen poetischen Verwünschungen. Die sind dann in viele Sprachen übersetzt worden, auch ins Ukrainische. Die bekannteste ist zum Beispiel: „Alle Zähne sollen dir ausfallen bis auf einen, damit du weißt, wie sich Zahnschmerzen anfühlen.“ Es ist immer das Wünschen eines Unheils und auch eine Verstärkung, so als wäre das nicht genug. Im Ukrainischen sind Verwünschungen sehr häufig.
Alle ersten Reaktionen auf Bombardierungen am 24. Februar waren Verwünschungen, an die russischen Soldaten und Putin gerichtet. Ich habe dann einen Text für die Presse geschrieben: „Sprache zu Kriegszeiten: Sei verflucht! Verrecke! Krepiere.“ Der Text erschien im März, zwei bis drei Wochen nach Kriegsausbruch, aber man konnte schon diese Dynamik sehen. Verwünschungen sind ein passiver Sprechakt. Die Erfüllung der Verwünschung ist nicht vom Sprechenden selbst abhängig oder der Sprechende ist nicht selbst verantwortlich, sondern höhere oder niedrige Kräfte. Und das war Ausdruck der Fassungslosigkeit der Leute in diesem Moment, der Ohnmacht angesichts der grausamen Situation. Bei Tymofiy waren das sehr schöne Verwünschungen, die kommen auch in dem Text vor. Ich habe sie ins Deutsche übersetzt. Und dann kamen schon aktive Sprechakte. Beschimpfungen, auch Forderungen an die Okkupanten. Zum Schluss kam auch der Humor dazu. Der Humor hilft, schwierige grausame Situationen durchzustehen. Wenn zum Schimpfen noch das Auslachen kommt, der Humor, dann ist die kathartische Funktion doppelt so stark, denn beide Mechanismen – das Auslachen, das Schimpfen – haben diese kathartische Wirkung und zusammen wird das noch verstärkt.
Ich telefoniere mit meinen Eltern und höre die Sirene und sage zu ihnen: „Ihr müsst euch verstecken und in Sicherheit bringen.“ Papa sagt dann, dass sie dazu „Symphonie“ sagen. Es gibt unzählige Beispiele dieses Humors. Ich habe schon sehr viel Belegmaterial gesammelt und arbeite jetzt auch an einem wissenschaftlichen Beitrag zum Thema Sprache und Krieg.
Welche Tipps würden Sie Studierenden generell geben, die nach Österreich kommen wollen?
Man sollte so viele Kontakte wie möglich knüpfen. Es spart Zeit bei anderen Hürden, wenn man etwas organisieren will. Man kennt dann jemanden, der mit dir dort war und weiß, welche Stellen oder Unis man kontaktieren sollte. Diese persönlichen Kontakte sind für mich sehr wichtig. Kontakte knüpfen zu anderen OeAD-Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus anderen Ländern in Österreich. Später kann das eine Form von interessanten Projekten annehmen, die man sich jetzt noch nicht vorstellen kann.
Akademische Titel spielen noch eine wichtige Rolle in Österreich. Man sollte immer schauen, was auf der Visitenkarte steht: Mag. Mag. Ing., und alles anführen, wenn man eine E-Mail schreibt. Das spielt schon eine wichtige Rolle. Das haben zuletzt auch meine Kinder beim Arzt gespürt. Nachdem ich die E-Card hergegeben habe, änderte sich gleich der Ton: „Ja, Frau Dr.!“ Mein Sohn war beeindruckt, dass man mich so angeredet hat und ich habe gesagt: „Siehst du, es lohnt sich zu lernen, du wirst ganz anders behandelt.“
Österreicher/innen und Wiener/innen sind nicht so grantig wie sie behaupten. Sie wollen dem Stereotyp entsprechen. Es gibt diese Konkurrenz, dass nur Pariser/innen unfreundlicher sind als wir. Die wichtigsten Wörter und Wendungen sowie österreichischen Ausdrücke sollte man lernen. Das ist auch ein höfliches Zeichen und hilft in der Kommunikation. Oft versteht man sonst etwas nicht. Ich kann mich erinnern, als ich 1994 am Naschmarkt Mohrrüben kaufen wollte, wie ich es gelernt habe, und der Verkäufer hat mir rote Rüben gegeben.
In Österreich rede ich so wie ich rede, bei erwachsenen Leuten bemerke ich nie, dass sie mich sonderbar anschauen wegen meines Akzents. In Deutschland dagegen, als Tymofiy an der Humboldt-Universität unterrichtet hat, bin ich im Sommer mit den Kindern gekommen. Da war mein Sohn 8 Jahre alt und Kung Fu-Panda so populär. Gleich ums Eck war eine Kung Fu-Schule und ich wollte meinen Sohn anmelden. Ich habe dort angerufen und habe mich bemüht, dieses Deutsch, das ich an der Uni gelernt habe, zu sprechen. Ich habe geglaubt, ich kriege das gut hin und der Mann am Telefon hat gesagt: „Hallo Kathi, bist du das?“ Und ich dachte: Wow, er denkt ich bin eine Kathi! Ich rede schon so gut Deutsch. Ich sagte: „Nein, da ist nicht die Kathi.“ Und er hat dann gesagt: „Ah, ich hab gedacht, das ist eine Bekannte von mir aus Ungarn, die hat auch so einen Akzent.“
Links:
Interview mit Timofiy Havryliv
Oksana und Timofiy über die Bedeutung, sich in schwierigen Zeiten der Wissenschaft zuzuwenden