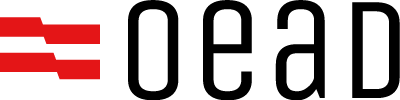Es ist im Studierendenalltag noch nicht lange her, dass die Studienauswahl überschaubar war und der Ruf einer Hochschule von Erfahrungen aus dem Familienkreis oder von bestimmten Professorinnen und Professoren abhing. Besonders hohe Studienabbruchquoten oder das „Rausprüfen“ in den niedrigen Semestern wurden fast als Kavaliersdelikt abgetan – nur die „Harten“ sollten durchkommen.
Die Meinung oder fachlichen Vorkenntnisse der Studierenden waren vernachlässigbar, sodass auch Evaluierungen von keiner Seite besonders ernst genommen wurden. So genannte „first generation“-Studierende brachen nicht selten bereits im ersten Semester wieder ab, weil sie daheim im nicht-akademischen familiären Haushalt nur unter Auflagen gefördert wurden und sich in der akademischen Welt nicht wohl oder zumindest wohlwollend wahrgenommen fühlten.
Auslandsaufenthalte stellten eine Bruchlinie im Studienver- bzw. Lebenslauf dar, aber auch internationale Lehrende wie Kommilitoninnen und Kommilitonen galten gemeinhin als exotisch. Der Elfenbeinturm wurde heftig verteidigt, es wurde in Frage gestellt, ob die eigenen Lehrinhalte auch im Ausland erlernbar seien. „Lernergebnis“ war ein Fremd- und „Vergleichbarkeit“ ein Unwort, Anrechnungen aus dem Ausland hingen zuweilen sogar vom Wohlwollen der Studiendekane ab.
Das Curriculum selbst hatte sich den Forschungs- und Lehrgegenständen der avancierten Professorinnen und Professoren anzupassen. Überhaupt war es den durchschnittlichen Studierenden bei Studienantritt nicht klar, welche Kompetenzen oder Fähigkeiten sie sich bei LV- oder auch Studienabschluss aneignen würden. Der persönliche zeitliche Aufwand für das Studium war kein Thema – wie hätte man es auch nachweisen können? Gemessen wurde in Wochenstunden aus Perspektive der Lehrenden. Für Studierende mit beruflichen oder familiären Verpflichtungen waren Mobilität, die ständigen Präsenzformate bzw. die Öffnungszeiten der Bibliotheken ernsthafte Hemmschuhe für einen erfolgreichen Studienabschluss.
Umgekehrt war der Druck während des Studiums geringer, die Studierenden waren weitaus weniger pragmatisch, jagten selten ECTS-Credits hinterher und der Kontakt zu den Professorinnen und Professoren spätestens auf Ebene des Diplomandenseminars war auch persönlicher. Die zahllosen Projektarbeiten in der Bibliothek, das gemeinsame Harren vor dem defekten Kopierer oder vor verschlossenen Türen trotz scheinbarer Sprechstunden und der dadurch aufkeimende Unmut gegen bestimmte Lehrende schweißte auch für die Zeit nach dem Studium zusammen.
Derlei Netzwerke boten einen fruchtbaren Boden für den Übergang zwischen Studium und Karriere, ein Career- oder Alumni-Service existierte nicht. Ein Studienabschluss selbst galt als Garant für einen lebenslangen Job und eigentlich war vor den europäischen Harmonisierungsbestrebungen durch "Bologna" sowieso alles besser, denn man blieb doch recht gern unter sich.
Soweit – so provokant, und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
„Culture eats strategy for breakfast“ – nichtsdestotrotz hat sich in den vergangenen 20 Jahren an Hochschulen und für Studierende unglaublich viel verändert. Die Hochschulen per se bewegen sich global in fünf großen Spannungsfeldern* : Nationale Prioritäten vs. europäische / internationale Bildungsräume; Regulative der jeweiligen Regierungen vs. institutionelle Autonomie; steigende Diversität vs. Harmonisierungsbestrebungen wie durch den Bologna-Prozess; Wettbewerb vs. Kooperation; geistiges Eigentum vs. Open Access.
Internationalisierung.
Somit kann es sich heute keine Hochschule mehr leisten, Mobilität und Internationalität für Studierende, Lehrende, Verwaltungspersonal und Forschende nicht aktiv zu fördern. Oder umgekehrt, nicht-mobilen Studierenden wenigstens im Rahmen der Lehre die Möglichkeit zu bieten, sich ein Grundmaß an interkulturellen Fähigkeiten anzueignen bzw. ein „experience the otherness“ zu vermitteln, oder virtuell Aufgaben mit internationalen Teilnehmenden in einem geschützten Raum durchzuspielen. Die persönliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Denk-, Vermittlungs-, Arbeits-, Organisationskulturen ist in einer globalisierten Arbeitswelt genauso unerlässlich wie im digitalen Raum, der uns scheinbar alle so leicht und so nah zusammenwachsen lässt.
Digitale Transformation.
Die Hochschulen haben in den letzten Jahren erkannt, wie ubiquitär sie Digitalisierung (be-)trifft, wobei europäische Strategien, Initiativen und Rahmenwerke eine wesentliche Richtschnur bieten. Beispielhaft genannt seien die Publikationen des Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission („European Framework for Digitally Competent Educational Organisations“), das white paper „Bologna Digital 2020: digitalisation of Higher Education in Europe“ oder die zahlreichen Projekte, die unter Erasmus Without Paper (EWP), der European Student Card Initiative (ESCI) oder Erasmus+ goes digital inklusive einer Erasmus+ App als „Single Point of Access” für Studierende subsummiert werden können.
Transparenz und innovative Lehre.
Die digitale Transformation zeigt sich somit in der Hochschulverwaltung, bei den seit dem Bologna-Prozess eminent gewachsenen Service-Einrichtungen wie Qualitätssicherung, Lehrservice; in der Information und Organisation, in der LV-Evaluierung, im Hochschulmarketing und somit im Tracking vor, während (Stichwort Studienaktivität) und nach dem Studium, in der Bindung der Alumnae und Alumni und natürlich in der Lehre und Forschung. In der Lehre sind im Zusammenspiel von Präsenz- und Fernlehre der Fantasie aller Beteiligten keine Grenzen mehr gesetzt. Voraussetzung dafür ist das notwendige technische Rüstzeug, Service und Zeit für die Erarbeitung von innovativen Lehrformaten auf Seite der Lehrenden.
Die soziale Dimension.
Bei den vermeintlichen „digital natives“ sind durch die zeitliche und örtliche Flexibilisierung der Lehre Selbstorganisation, Wissensaneignung und -management, Medienkompetenz sowie ein digitales Grundverständnis gefragt. Der Aufwand dafür lohnt sich, ist jedoch nicht für alle leicht verdaulich, insbesondere mit dem empirisch nachweisbaren Blick auf eine immer buntere Studierendenschaft.
Spätestens 2007 brachte die Forderung der Bildungsministerinnen und -minister im Bologna-London-Communiqué den Elfenbeinturm hochoffiziell gehörig ins Wanken.
Sie forderten, „[…] dass die Zusammensetzung der Studierenden, die in das Hochschulsystem eintreten, daran teilhaben und einen Abschluss erlangen, auf allen Ebenen die Diversität unserer Bevölkerungen widerspiegeln sollen.“
Die Anzahl der Studierenden sinkt mitunter aus demografischen Gründen, die Studierendenschaft wird im Durchschnitt insgesamt älter, hat familiäre oder berufliche Verpflichtungen. Ein auf den klassischen 18-jährigen Vollzeitstudierenden mit Studienstart unmittelbar nach Abschluss der Matura ausgerichtetes Curriculum funktioniert schon lange nicht mehr. Der akademische Blick, die Beratung und Begleitung wendet sich demnach immer intensiver der Studieneingangsphase und den individuellen Rahmenbedingungen der Studierenden zu.
Die Hochschule von heute soll und möchte allen Talentierten und Motivierten eine Chance zu einem Studienabschluss bieten und sie dahingehend von Anfang an bestmöglich begleiten. Denn auch der schillerndste Turm wirkt schal, wenn er sich zunehmend leert und man sich enttäuscht von ihm abwendet.
Autorin: Regina Aichner, Teamkoordinatorin Daten, Analyse, Bologna-Prozess
* Sarah Guri-Rosenblit (The Open University of Israel) Internationalization of Higher Education: Navigating between Contrasting Trends, Bologna Researchers‘ conference 2014.