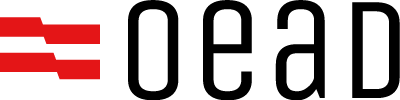Unter dem Titel „Citizen Science: Zwischen Demokratisierung der Wissenschaft und globalen Herausforderungen“ diskutierten Ulrike Felt (Universität Wien), Gerald Bast (Universität für angewandte Kunst Wien), Anne Overbeck (Deutsches Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), Stefan Duscher (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, BMBWF) und Klement Tockner (Wissenschaftsfonds, FWF), moderiert von Susanne Hecker (Bürger schaffen Wissen, Museum für Naturkunde Berlin). Nach einer Begrüßung durch Petra Siegele, Leiterin des OeAD-Zentrums für Citizen Science, wurde ein weiter Bogen zwischen zwei großen Ansprüchen von Citizen Science gespannt, einerseits dem Anspruch, Wissenschaft zu demokratisieren und andererseits dem Anspruch, zur Lösung der großen globalen Herausforderungen bzw. zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beizutragen.
Zwischen Demokratisierung der Wissenschaft und „Oligopolisierung des Wissens“
Bereits zu Beginn zeigte sich, dass die Frage, inwiefern Citizen Science zu einer Demokratisierung von Wissenschaft beitragen kann, viel früher ansetzen muss, nämlich bei der Frage, was genau unter Demokratisierung zu verstehen ist und für wen etwas demokratischer werden soll. So stellte etwa Gerald Bast einen Vergleich zwischen den Demokratisierungsbewegungen der Politik vor 100-200 Jahren und den Entwicklungen, die aktuell in der Wissenschaft stattfinden, her. In beiden Bereichen ging und geht es darum, die Elite-Funktion einer Minderheit in Frage zu stellen, wobei eine aktuelle Herausforderung auch darin bestehe, das System „Bildung“, welches durch zunehmende Fragmentierung gekennzeichnet sei, im Demokratisierungsprozess der Wissenschaft mitzudenken.
Ulrike Felt gab zu bedenken, dass die Teilnahme an Citizen-Science-Projekten den Mitforschenden Ressourcen (zeitliche, finanzielle, geistige) abverlange, die nicht jede Bürgerin bzw. jeder Bürger gleichermaßen zur Verfügung habe oder im selben Ausmaß aufwenden könne oder möchte. Es müsste ein Bewusstsein für Machtdimensionen geschaffen werden, welche nicht nur zwischen Wissenschaft und Gesellschaft vorherrschen, sondern auch innerhalb von Bürgerinnen- und Bürgergruppen. So könnte es Felt zufolge leicht passieren, dass unter dem Label „Demokratisierung“ neue Formen von Ausschluss produziert werden. Demokratisierung bedeute auch, dass es für Menschen möglich sein müsse, Wissen zu hinterfragen und die richtigen Fragen zu stellen, was wir nicht einfach nur können, sondern lernen müssten. Zentral sei zu hinterfragen, für wen neue Gestaltungsräume aufgemacht würden, oder ob dies nicht einfach nur eine neue Elite sei, die Ungleichheiten reproduziert.
Die Gefahr der Entstehung einer neuen Elite thematisierte auch Klement Tockner. Diese Entwicklung stehe der Forderung nach mehr transdisziplinärer Forschung unter Einbindung unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure diametral gegenüber. Tockner zufolge könne derzeit eine „Oligopolisierung des Wissens“ beobachtet werden, die gekennzeichnet sei durch eine Zunahme von Privatisierung im Bereich der Wissensgenerierung durch Industrie, Militär und Geheimdienste, bei gleichzeitiger Abnahme der öffentlichen Hand. So stellte Tockner die Frage, wie mit dem Paradox umgegangen werden solle, dass Wissen zwar vorhanden sei, aber aus ökonomischen, politischen oder ideologischen Gründen nicht zugänglich gemacht würde.
Anne Overbeck und Stefan Duscher beleuchteten den Demokratisierungs-Anspruch von Citizen Science aus dem Blickwinkel der Ministerien. Overbeck betonte, dass Demokratisierung dadurch stattfinden könne, dass die Zivilgesellschaft bei der Vergabe von Förderungen berücksichtigt werde. In Deutschland seien bei vergangenen Citizen-Science-Ausschreibungen Forschungseinrichtungen als Antragstellende in den Mittelpunkt gestellt worden. Bei der aktuell laufenden Förderrichtlinie würde hingegen bewusst die Zivilgesellschaft hereingeholt. So können sich nun auch zivilgesellschaftliche Institutionen als Projektleitungen bewerben und wissenschaftliche Einrichtungen als nachgeordnete Partner mit in die Verbünde aufnehmen. Darüber hinaus plädierte Overbeck für mehr Begleitforschung, um herauszufinden, was mit Citizen Science tatsächlich erreicht und inwiefern letztere den unterschiedlichen an sie herangetragenen Ansprüchen – inklusive dem Anspruch nach Demokratisierung der Wissenschaft – gerecht werden kann.
Auch Stefan Duscher sprach sich für eine verstärkte Öffnung der Wissenschaft gegenüber der Bevölkerung aus und betonte, dass Demokratisierungsbestrebungen bereits in einem frühen Lebensalter ansetzen müssten. So habe das BMBWF mit dem Sparkling-Science-Förderprogramm bewusst bei Kindern und Jugendlichen angesetzt, um Barrieren zwischen Wissenschafts- und Bildungssystem abzubauen und so zu einer Demokratisierung von Wissenschaft an den Wurzeln beizutragen. Auf Grund des großen Erfolgs von Sparkling Science – im Rahmen von sechs Ausschreibungen wurden knapp 300 Forschungsprojekte gefördert, an denen mehr als 100.000 Personen beteiligt waren – arbeite das BMBWF derzeit auf Hochtouren an einem Nachfolgeprogramm. Dabei sei besonders wichtig, dass im kommenden Förderprogramm auch Forschungseinrichtungen und Schulen im ländlichen Raum bzw. periphereren Gebieten angesprochen würden.
Lokale Antworten für globale Herausforderungen
Zwischen den Diskutantinnen und Diskutanten herrschte Konsens darüber, dass Citizen Science vor allem dann Antworten auf globale Herausforderungen geben könne, wenn auf lokaler Ebene gehandelt würde. Im Hinblick auf globale Fragestellungen komme es oftmals weniger darauf an, wissenschaftliche Beiträge im klassischen Sinn zu leisten, als vielmehr darum, Bewusstsein für bestimmte Fragestellungen zu schaffen. Ulrike Felt veranschaulichte dies anhand eines Beispiels aus ihrer eigenen Forschung zum Thema Plastik. So könne etwa die Frage gestellt werden, inwiefern es Sinn mache, Menschen zu erklären, dass sie weniger Plastikflaschen verwenden sollen, denn angesichts des globalen Plastikproblems sei der Anteil an Plastikflaschen verschwindend gering. Zentral sei jedoch weniger der wissenschaftliche Beitrag, sondern vielmehr, dass Menschen durch diese kleine Geste zu verstehen beginnen, wie groß das Plastikproblem eigentlich ist. Auch Klement Tockner unterstrich, dass es keine einfachen und linearen Antworten auf die großen globalen Herausforderungen geben könne und es viel wichtiger sei, Komplexität, aber auch Unsicherheiten aufzuzeigen. Einig war sich das Podium darin, dass Citizen Science allein die globalen Herausforderungen nicht lösen könne.
Ein weiterer Aspekt, der von Klement Tockner aufgeworfen wurde, betrifft die Schwierigkeit eines Zusammenbringens von lokalem Wissen, welches etwa im Umweltbereich bei vielen lokalen NGOs vorhanden sei, mit der Wissenschaft, weil z.B. Kontakte fehlen. Tockner zufolge gäbe es Möglichkeiten, diese beiden Akteure zusammenzubringen, beispielsweise indem regionale Aktivitäten durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor den Vorhang geholt würden. Stefan Duscher argumentierte, dass es bereits jetzt in Österreich Beispiele für gelungene Citizen-Science-Projekte gebe, bei denen exzellente Forschungsgruppen, wie etwa am Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), erfolgreich mit Citizen Scientists zusammenarbeiten und durch großangelegte Datensammlung zum Monitoring der globalen Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) beitragen.
Gerald Bast forderte einen noch stärkeren Einbezug lokaler Expertisen gerade wenn es um globale Herausforderungen gehe, denn das aktuelle Wissenschafts- und Forschungssystem mit seinen klassischen Bewertungsschemata entlang von Indikatoren wie Publikationserfolgen, Projekteinwerbungen etc., führe gerade dazu, dass lokale Expertisen, die außerhalb dieser Logiken existieren, ausgeklammert werden. Heute würden anerkannte Expertinnen und Experten in den ländlichen Raum reisen, mit ein paar Leuten reden und dann wieder zurück an ihre Forschungseinrichtungen in den Städten fahren, wo sie zurückgezogen in ihr Kämmerchen ein intelligentes Buch schreiben, da einzig und allein Publikationstätigkeit ihre Karriere befördere.
Als weiteren Aspekt nannte Anne Overbeck, dass eine Verknüpfung von Citizen Science mit den globalen Herausforderungen bzw. SDGs nicht nur auf Grund von Bewusstseinsbildung und wissenschaftlichen Beiträgen gewinnbringend sei, sondern auch strategisch sinnvoll. Indem „etablierte politische Marker“ – wie eben die SDGs – mit weniger prominenten Themen, wie Citizen Science, verknüpft würden, schreibe man sich in Diskurse ein, die sehr viel mehr Wirkungsmacht hätten. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund internationaler Vernetzung zentral. Als Beispiel nannte Overbeck die Konferenz Knowledge for Change: A decade of Citizen Science (2020-2030) in support of the SDGs mit einem zugehörigen Citizen-Science-Festival, welche kürzlich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stattgefunden haben.
Quo vadis Citizen Science?
In einer Abschlussrunde teilten die Podiumsgäste ihre Visionen und Wünsche für die Zukunft, wobei diese durchaus heterogen ausfielen. So äußerte Anne Overbeck den Wunsch, dass Citizen Science zukünftig noch viel besser verstanden wird als heute und als etablierte Methode im Werkzeugkasten jeder Doktorandin und jedes Doktoranden enthalten sein sollte. Auch für Stefan Duscher war ein zentrales Anliegen, dass Citizen Science spätestens in zehn Jahren als Forschungsansatz oder Set an Methoden im Mainstream der Forschungslandschaft angekommen sein sollte, was auch durch ein Nachfolgeprogramm für Sparkling Science vom BMBWF unterstützt würde.
Etwas weiter holte Gerald Bast aus, der sich eine Reform der Wissenschafts- und Bildungssysteme wünschte, aus welchen Bürgerinnen und Bürger mit neuem Wissen bestückt hervorgehen und sich ihrer unterschiedlichen Kompetenzen bewusst sein würden. Jedenfalls sollte es in der Zukunft ein anderes Bild von Forschung geben, das sich nicht ausschließlich über wissenschaftliche Publikationen definieren würde. Auch Klement Tockner schlug in diese Kerbe und betonte, dass sich die Bürgerinnen und Bürger wieder bewusst werden müssten, dass wir von Geburt an Forscherinnen und Forscher sind, aber dass uns die angeborene Neugierde durch das Bildungssystem ausgetrieben werde. Es müsse gelingen, den Menschen wieder klar zu machen, dass jede und jeder sich in irgendeiner Form in die Wissenschaft einbringen könne. Wenn dies gelänge, gäbe es neun Millionen Forscherinnen und Forscher in Österreich, achtzig Millionen in Deutschland und 430 Millionen in Europa.
Dem Wunsch nach einer differenzierteren Vorstellung von Wissenschaft schloss sich auch Ulrike Felt an. Ihr zufolge würden sich Wissensdynamiken aktuell rasant verändern, weshalb sich auch Wissensräume verändern müssten. Ferner stellte sie die Frage oder Vision in den Raum, dass es vielleicht ein besseres Sensorium brauchen wird, um die Prozesse, die sich rund um die Öffnung der Wissenschaft abspielen, verstehen zu können.