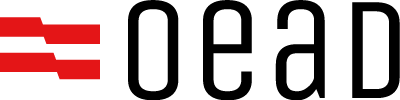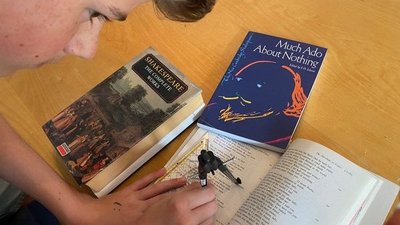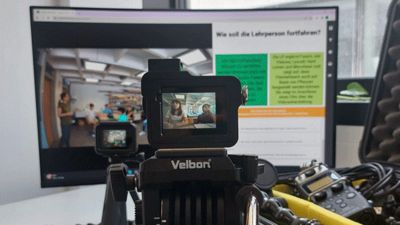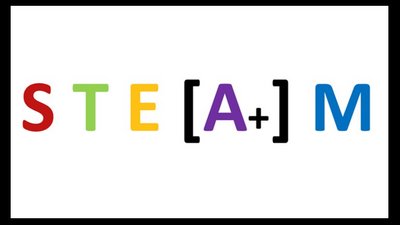Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung
Aktuelles
Die Einreichfrist zur Ausschreibung ist beendet.
Wir bedanken uns bei allen einreichenden Universitäten und Pädagogischen Hochschulen.
Die Initiative „Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung B3“ wurde von Seiten des Bundesministeriums für Bildung (BMB) und des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) gestartet, um den Bildungsforschungsbereich durch die Schaffung kooperativer Doktoratsprogramme zwischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen zu stärken. Mit Fördermitteln in Höhe von rund 8. Mio. Euro konnten insgesamt 48 Dissertationsprojekte zu höchst relevanten Themenbereichen der Bildungsforschung für eine Laufzeit von drei Jahren gefördert werden. Die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) fördert Aktivitäten und Maßnahmen zum Aufbau einer "Research Community" zusätzlich mit 800.000 Euro.
Achtung: Der 2. Call wird direkt über das Ministerium koordiniert. Bezüglich Informationen und Fragen zur 2. Ausschreibung wenden Sie sich bitte an GeSte.Bildungsforschung@bmbwf.gv.at
Informationen zur Initiative
Gefördert: 9 Konsortien, 48 Doktorand/innen
Laufzeit: 2024 bis 2026
Zu beforschende Themenbereiche:
- Digitalisierung - Distance Learning
- Fachfremder Unterricht
- Kompetenzorientiertes Unterrichten
- Früher Bildungsabbruch (Early School Leavers)
- Sprachunterricht und Lesekompetenz
- Schulentwicklungsberatung
- Resilienz von Schüler/innen
Ziel der Initiative
Ziel der Initiative „Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung – B3“ ist die Vertiefung eines interdisziplinären und interinstitutionellen Austausches sowie die Stärkung des Bildungsforschungsbereiches durch die Schaffung von dreijährigen kooperativen Doktoratsprogrammen zwischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen. Durch Bündelung der individuellen Stärken von Universitäten und Pädagogischen Hochschulen soll der Transfer von Forschungsergebnissen in die schulische Praxis intensiviert und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf hohem Niveau gestärkt werden.
Umsetzung der Ziele
Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt in einem Basismodul welches durch das begleitenden Aufbaumodul zur Initiative B3 bestmöglich ergänzt wird, um die Research Community in der Bildungsforschung (inter)national zu stärken.
Zweistufige Ausschreibung:
- Basismodul „Doktoratsprogramm“ (Mittel des BMB und BMFWF): Finanzierung von Stellen für Doktorandinnen und Doktoranden sowie Ausbildungskosten und allgemeine Projektkosten
- Aufbaumodul „Research Community“ (Mittel der ISB): Förderung von Maßnahmen zur Vernetzung, Austausch und Wissenstransfer, Stärkung einer Peer-Kultur z.B. durch Seminare, Veranstaltungen mit externen internationalen Expertinnen und Experten, mit Personen aus den Praxisschulen der Pädagogischen Hochschulen oder der (Bildungs-)Verwaltung, Summer Schools, PhD-Konferenzen, Abschlusskonferenz
Aufbaumodul "Research Community" nach Förderzusage
Für bewilligte Doktoratsprogramme konnten die Konsortien bei der Innovationsstiftung für Bildung um weitere Förderungen ansuchen. Weitere 800.000 Euro standen für Maßnahmen zur Vermittlung von zusätzlichen Qualifikationen, zur Internationalisierung und Stärkung einer Peer-Kultur (Förderung einer Research Community) bereit. Mit den Fördermitteln konnten 11 konsortiumsübergreifende Maßnahmen über die gesamte Laufzeit von drei Jahren (Herbst 2024 bis Ende 2026) gefördert und umgesetzt werden.
Ziel dieser Maßnahmen ist es, eine nachhaltige Forschungsgemeinschaft aufzubauen und die Zusammenarbeit zwischen den Konsortien zu fördern.
FAQs Basismodul
VERTRÄGE/LAUFZEIT/KARENZEN
Frage:
Darf mit den Mitteln für die Ausbildungskosten oder die allgemeinen Projektkosten auch ein Werkvertrag für die Betreuung eines/r Dissertanten/in bezahlt werden?
Hintergrund: an einer PH ist eine Dissertations-Betreuung nicht Teil der Aufgabe einer Hochschulehrperson (da. An einer PH normalerweise keine Dissertant/innen betreut werden).
Antwort:
Ob ein Werkvertrag für Personen an der PH möglich ist, liegt im Entscheidungsrahmen des BMB und BMFWF als Fördergeber.
Die Ausbildungskosten dürfen keinesfalls dafür verwendet werden, da diese per se nur für die/den Doktorand/in zur Verfügung stehen.
Frage:
Wie soll vorgegangen werden, wenn eine Doktorandin/ein Doktorand eine Karenzzeit während der 3-jährigen Laufzeit antritt?
Antwort:
Sollte dieser Fall eintreten, muss dies so früh als möglich an den OeAD gemeldet werden. In Abstimmung mit dem BMB und BMFWF wird eine Lösung (kostenneutrale Verlängerung der Stelle) gefunden werden. Die Laufzeit wird für die Doktorandin/den Doktoranden verlängert. Das gesamte Programm sollte aber aus heutiger Sicht mit 31.12.2026 enden. Wann im Falle einer Verlängerung der Endbericht zum Doktoratsprogramm gelegt werden soll, wird in Absprache mit dem BMB und BMFWF entschieden.
Frage:
Müssen Doktoratsstellen zu 100% besetzt werden oder können Bewerber/innen auch z.B. zu 80% angestellt werden?
Antwort:
Für Pädagogische Hochschulen gilt:
Es ist zwischen den neu zuzuteilenden Assistenzstellen und den Personen aus dem Stammpersonal der PHs, die am Doktoratsprogramm teilnehmen, zu unterscheiden.Die Assistenzstellen werden mit 100% Beschäftigungsausmaß den PHs zugeteilt und sind auch so auszuschreiben und zu besetzen. Beim Stammpersonal liegt die Auswahl und damit auch das Beschäftigungsausmaß dieser Personen in der Verantwortung der PH.
Für Universitäten gilt:
Entsprechend den Vorgaben in der Richtlinie: Eine 100%-Anstellung an der Universität entspricht den Personalkosten gemäß den FWF-Personalkostensätzen mit einer 30h-Anstellung inkl. Valorisierung über die nächsten drei Jahre. Es müssen aber jedenfalls kollektivvertragliche Regelungen an den Universitäten eingehalten werden.Wenn ein Anstellungsverhältnis von 30 Stunden zur Dissertationserstellung weiter reduziert wird, werden entweder die wissenschaftliche Qualität, die Zeitschiene oder der erfolgreiche Dissertations-Abschluss generell darunter leiden und ist daher nicht zu empfehlen.
Frage:
Können Doktorandinnen und Doktoranden für weniger als 30 Stunden und dafür länger als 3 Jahre angestellt werden?
Antwort:
Die Ausschreibungsrichtlinie zur Bildungsforschung enthält klare Vorgaben zu den Kostenaufteilungen.
Von diesen Rahmenbedingungen kann nicht abgewichen werden, da diese Regelung zum einen für alle Konsortien gelten muss und zum anderen, da dies auch ein Qualitätsmerkmal in der strukturierten Doktoratsausbildung darstellt.
Allgemeines zur Verwendung der Mittel (lt. Richtlinien)
Gültig für beide Institutionstypen:
Finanzier-/förderbar sind ausschließlich projektspezifische Kosten, d.s. Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung der Projekte benötigt werden und über die von der Infrastruktur, der von den beteiligten Forschungsstätten bereitgestellten Ressourcen hinausgehen.
Für Sachkosten steht die Kostenkategorie „allgemeine Projektkosten“ zur Verfügung. Allgemeine Projektkosten (u.a. Verbrauchsmaterial, Publikationskosten, Reisekosten für die Konsortiums-Mitglieder und unvorhergesehene Ausgaben, KEINE Overhead-Kosten), müssen mit fünf Prozent der beantragten Mittel gedeckelt sein.
Das Budget für Pädagogische Hochschulen und Universitäten innerhalb der Konsortien ist streng getrennt. Es gibt je nach Fachsektion unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten:
Für Pädagogische Hochschulen gilt zusätzlich:
Personalkosten der Doktorandinnen und Doktoranden werden direkt mit dem Beginn der Anstellung übernommen. Auf PH-Seite werden alle Kosten (Ausbildungskosten und allgemeine Projektkosten – z.B. Sachkosten) direkt abgerechnet. Die Kosten sind mit der Fachsektion im BMB u.a. im Rahmen der Jahresgespräche über das Haushaltsprogramm zu klären.
Die Sachbudgets wurden für 2024 mit den PHs in den Jahresgesprächen im November festgelegt.
Darin sind die Ausbildungskosten und allgemeine Projektkosten für 2024 je PH zusammengerechnet und dem Programm „Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung“ zugewiesen. Detailfragen gehen bitte an die Ansprechperson in der Abteilung II/6 des BMB.
PH-seitige Ausbildungskosten sind in den Richtlinien folgendermaßen festgelegt:
je Doktorand/in werden (für Auslandsaufenthalte, Reisekosten zu Konferenzen und Veranstaltungen u.ä.) ein Maximalbetrag von 5 000 Euro pro Doktorand/in und Jahr zur Verfügung gestellt. Diese können nicht von einem Jahr ins nächste mitgenommen werden.
Für Universitäten gilt zusätzlich:
Die Ausbildungskosten der Doktorandinnen und Doktoranden an den Universitäten (5.000 Euro/Doktorand/in/Jahr) sowie die allgemeinen Projektkosten des Universitäts-Budgets gehen gemeinsam mit den Personalkosten der Doktorandinnen und Doktoranden an der Universität vom BMB über ergänzende Leistungsvereinbarungen direkt an die Universität. Die erste Rate wird, nach Freigabe des Startberichts, in der Höhe von 60% der gesamten Summe an die Universität überwiesen.
Sollten die in der Ausschreibung veranschlagten Ausbildungskosten (individuelle Kosten für die Ausbildung der Doktorandin/des Doktoranden wie Auslandsaufenthalte, Reisekosten zu Konferenzen und Veranstaltungen) iHv. 5.000 Euro/Jahr und Doktorand/in nicht zur Gänze im laufenden Jahr verbraucht werden, können die restlichen Mittel ins nächste Jahr mitgenommen werden. Mit den Ausbildungskosten können auch z.B. Weiterbildungen finanziert werden, die im Rahmen der Betreuungsgespräche festgelegt werden.
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zur Geringfügigkeitsgrenze (2023/2024: € 1.000) können direkt in die Abrechnung als “allgemeine Projektkosten” aufgenommen werden, darüber hinaus in Höhe der Abschreibungen über die Projektlaufzeit.
Frage:
Ab welchem Zeitpunkt können die zugewendeten Mittel verwendet werden?
Antwort:
Entsprechend der Richtlinie können Kosten nur abgerechnet werden, wenn diese während des Umsetzungszeitraums entstanden sind. Den Projektstart kann das Konsortium festlegen. Zum Beispiel mit der ersten Anstellung, frühestens jedoch mit dem Datum der Unterzeichnung der ersten ergänzenden Leistungsvereinbarung.
Frage:
Können Laptops und Bildschirme aus den Projektmitteln bestellt werden?
Antwort:
Finanzier-/förderbar sind ausschließlich projektspezifische Kosten, d.s. Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung der Projekte benötigt werden und über die von der Infrastruktur, der von den beteiligten Forschungsstätten bereitgestellten Ressourcen hinausgehen.
Für Sachkosten steht die Kostenkategorie „allgemeine Projektkosten“ zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, dass Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zur Geringfügigkeitsgrenze (2023/2024: € 1.000) direkt in die Abrechnung aufgenommen werden können, darüber hinaus in Höhe der Abschreibungen über die Projektlaufzeit.
Entsprechend der Richtlinie können Kosten nur abgerechnet werden, wenn diese während des Umsetzungszeitraums entstanden sind. Den Projektstart kann das Konsortium festlegen. Zum Beispiel mit der ersten Anstellung, frühestens jedoch mit dem Datum der Unterzeichnung der ergänzenden Leistungsvereinbarung.
Frage:
Kann im Rahmen der Ausbildungskosten Zusatzausrüstung (wie bspw. Laptops für die Doktorandinnen und Doktoranden) bestellt werden?
Antwort:
Die Ausbildungskosten haben laut Richtlinien einen genau definierten Zweck, welcher gemäß Ausschreibung erfüllt werden muss. Zusatzausrüstung wie Laptops oder andere geringwertige Wirtschaftsgüter können nicht über die “Ausbildungskosten”, sondern müssen über die “allgemeinen Projektkosten” abgerechnet werden.
Frage:
Was ist bei nachträglichen Kostenumschichtungen zu beachten?
Antwort:
- Für Universitäten gilt:
- Umschichtungen zwischen Kostenkategorien (Personalkosten, Ausbildungskosten, Allg. Projektkosten) bis zu einem Ausmaß von 10 % der Kostenkategorie können ohne vorherige Rücksprache vorgenommen werden, müssen aber im Rahmen des Zwischen- bzw. Endberichts erläutert und begründet werden.
- Eine Kostenumschichtung über 10 % ist genehmigungspflichtig und muss im Vorhinein mit dem OeAD abgeklärt werden. Bei einer Umschichtung im Ausmaß von 10 bis 30 % kann der OeAD, nach Kommunikation mit dem BMB und BMFWF entscheiden.
- Ab einer Umschichtungshöhe von 30 % der Kostenkategorie entscheidet der Fördergeber über die Genehmigung.
- Sollten die in der Ausschreibung veranschlagten Ausbildungskosten iHv. 5.000,- €/Jahr und Doktorand/in nicht zur Gänze im laufenden Jahr verbraucht werden, können die restlichen Mittel ins nächste Jahr mitgenommen werden!
- Sinnvollerweise kann eine notwendige Umschichtung erst gegen Mitte oder Ende der Laufzeit des Projektes erfolgen.
- Für Pädagogische Hochschulen gilt:
- Auf PH-Seite werden alle Kosten direkt abgerechnet. Die Kosten sind mit der Fachsektion u.a. im Rahmen der Jahresgespräche zu klären.
- Bei den Ausbildungskosten zu beachten:
- Die Ausbildungskosten haben an sich einen definierten Zweck, weshalb generell darauf geachtet werden sollte, dass dieser gemäß Ausschreibung erfüllt wird.
- Sollten die in der Ausschreibung veranschlagten Ausbildungskosten iHv. 5.000,- €/Jahr und Doktorand/in nicht zur Gänze im laufenden Jahr verbraucht werden, können die restlichen Mittel ins nächste Jahr nicht mitgenommen werden.
Frage:
Können Ausbildungskosten in das Folgejahr mitgenommen werden?
Antwort:
Sollten die in der Ausschreibung veranschlagten Ausbildungskosten iHv. 5.000,- €/Jahr und Doktorand/in nicht zur Gänze im laufenden Jahr verbraucht werden, können die restlichen Mittel bei Dissertationsstellen an Universitäten ins nächste Jahr mitgenommen werden.
An Pädagogischen Hochschulen können nicht aufgebrauchte Ausbildungskosten NICHT ins Folgejahr mitgenommen werden.
Frage:
Muss die Person, die den Lead des Konosrtiums übernimmt, auch die Konsortiums-Koordination an seiner/ihrer Hochschule übernehmen?
Antwort:
Es ist möglich und meist auch der Fall, dass Konsortiums-Lead und Konsortiums-Koordination an der Hochschule nicht von derselben Person übernommen werden. Von Seiten der Richtlinie sind beide Varianten möglich. Aufgrund einer möglichen erhöhten Arbeitsbelastung durch die beiden Positionen ist die Trennung der beiden Positionen sinnvoll.
BERICHTLEGUNG
Frage:
Wann müssen die Zwischenberichte abgeliefert werden?
Antwort:
Nach der Hälfte der Laufzeit (Anfang/Mitte 2025). Beim Zwischenbericht ist neben dem Sachbericht ebenfalls eine vorläufige Kostenaufstellung erforderlich. Vorlagen für den Kostenplan und den Zwischenbericht erhalten die Konsortien zeitgerecht vom Programmteam.
Frage:
Wann müssen die Endberichte abgeliefert werden?
Antwort:
Der Endbericht ist ein Monat nach Abschluss des Programms vorzulegen. Hier gilt die anberaumte Laufzeit des Förderprogramms. Dem Endbericht ist neben dem ausführlichen Sachbericht auch ein zahlenmäßiger Nachweis für die verwendeten Mittel zu erbringen. Eine Vorlage für den Endbericht und die Kostenabrechnung erhalten die Konsortien zeitgerecht vom Programmteam.
Frage:
Was muss im Endbericht behandelt werden?
Antwort:
1. Ein Gesamtdokument bestehend aus folgenden Kapiteln:
- Kurzbericht zu Struktur, Ablauf und Organisation des Doktoratsprogramms
- Summary zu den Dissertationsthemen
- Ggf. Auflistung und Verlinkung zu bereits publizierten Beiträgen von Doktorand/innen bzw. dem Betreuer/innen-Team oder Manuskripte für eingereichte, aber noch nicht veröffentlichte Publikationen in Fachzeitschriften
- Vorschau auf geplante Vorhaben zur längerfristigen Zusammenarbeit der Konsortiums-Partner/innen
- Ggf. Beschreibung der durchgeführten doktoratsspezifischen Veranstaltungen im Rahmen des Aufbaumoduls “Research Community”
- Ggf. Beschreibung des Mehrwerts der gemeinsamen Maßnahmen für Doktorand/innen und Betreuer/innen-Team
- Beschreibung des Mehrwerts des Doktoratsprogramms
- Vorschau auf geplante Vorhaben zur längerfristigen Zusammenarbeit der Konsortiums-Partner/innen
- Zusammenstellung von Disseminationsaktivitäten und Medienberichten
- Fazit und Lessons Learnt
2. finale Kostenabrechnung:
Der zahlenmäßige Nachweis hat eine Aufgliederung aller mit der geförderten Leistung zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben zu umfassen (Gliederung analog des Kostenplanes im Antrag
Hat die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer von einem anderen Rechtsträger finanzielle Mittel erhalten, so hat der zahlenmäßige Nachweis auch diese zu umfassen.
Frage:
Wie erfolgt die Abnahme der Berichte?
Antwort:
Der Zwischenbericht wird wie der Startbericht von dem B3-Programm-Team des OeAD abgenommen.
Der Endbericht wird von externen Fachexpert/innen begutachtet. Neben der fachlich/inhaltlichen Evaluierung werden formale Rahmenbedingungen sowie Kosten vom OeAD geprüft.
Frage:
Sind die Belege aufzubewahren?
Antwort:
Die im zahlenmäßigen Nachweis angeführten Einnahmen und Ausgaben müssen durch Originalbelege nachweisbar sein, welche vom OeAD im Rahmen von Kontrollen auch angefordert werden können. Alle Belege sowie sonstige genannte Unterlagen sind – unter Vorbehalt einer Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch das BMB oder BMFWF / den OeAD in begründeten Fällen – zehn Jahre ab dem Ende des Jahres der Auszahlung der gesamten Förderung, jedenfalls aber bis zur vollständigen Rückzahlung, mindestens jedoch ab der Durchführung der Leistung sicher und geordnet aufzubewahren.
PUBLIKATIONEN/DRUCKSORTEN IM RAHMEN DER PROGRAMME
Frage:
So wie üblich, würden wir gerne unsere Förderung bei den Publikationen erwähnen. Gibt es dazu bestimmte Vorgaben bzw. Wünsche Ihrerseits? Gibt es z.B. auch eine Projektnummer unseres Programms, die wir nennen sollen oder ähnliches?
Antwort:
Die Konsortiums-Partner/innen sind verpflichtet, alle Veröffentlichungen, die aus dem Projekt hervorgehen, mit folgendem Hinweis zu versehen: „finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.“
Veröffentlichungen im Rahmen der Maßnahmen zum Aufbaumodul sind mit folgendem Hinweis zu versehen: „gefördert aus Mitteln der Innovationsstiftung für Bildung in Österreich“.
Auf Informationsmaterialien sind die Logos des BMB und BmFWF, der ISB sowie des OeAD anzubringen.
FAQs Aufbaumodul
EINREICHUNG
Frage :
Müssen die Meilensteine, die laut Richtlinie mit den Einreichungen abgedeckt sein müssen, über alle Projektanträge in Summe oder in jedem einzelnen Antrag abgedeckt sein?
Antwort:
Die Meilensteine müssen von allen Projektanträgen in Summe erfüllt sein.
Frage:
Können in den einzelnen Anträgen auch Verweise auf andere Anträge eingebracht werden, um auf die Durchlässigkeit in beide Richtungen zu verweisen?
Antwort:
Wenn kein gemeinsamer Antrag gestellt wird, dann kann in beiden Anträgen auf die gegenseitige Abstimmung verwiesen werden. Dazu gibt es im Antrag eine eigene Rubrik („Mit folgenden Maßnahmen anderer Konsortien interagiert/ergänzt sich das Maßnahmenset“).
KOSTENABRECHNUNG
Frage:
Kann für eine organisatorische und inhaltliche Unterstützung auch eine PraeDoc-Stelle ausgeschrieben werden?
Antwort:
Hinsichtlich förderbarer Personalkosten gibt es eine Vorgabe in den Richtlinien zum Aufbaumodul:
- Personalkosten von Mitarbeiter/innen der Konsortiums-Partner/innen oder auch
- Kosten für Dienstleistungen Dritter (Werkverträge)
Die Personal- und Reisekosten sind nur bis zu jener Höhe förderbar, die entweder dem Gehaltsschema des Bundes oder den Personalkostensätzen des FWF entsprechen oder auf entsprechenden gesetzlichen, kollektivvertraglichen festgelegten Bestimmungen beruhen und der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, i. d. F. BGBl. I Nr. 153/2020, für vergleichbare Bundesbedienstete entspricht.
Damit gibt es größere Handlungsfreiheit als im Basismodul und es können z.B. Personen entsprechend des KVs an der Universität angestellt werden. Das Stundenausmaß muss entsprechend der Tätigkeiten festgelegt werden, die Verhältnismäßigkeit beurteilen die Gutachter/innen.
Frage:
Darf eine organisatorische/administrative Position als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in angestellt werden?
Hintergrund: Die geplante Person kann leider aus persönlichen Gründen nun doch die 10 Stunden nicht antreten. Ein Masterstudent würde die Stelle gerne übernehmen. Darf ich die administrative Kraft als studentischen Projektmitarbeiter einstellen (Einstufung als wissenschaftliches Personal – da es für ihn im Lebenslauf besser aussehen würde). Finanziell würde es, da nun erst verspätet eingestellt werden kann, keinen Unterschied machen. Die Person würde dann statt 10 Stunden pro Woche 9 arbeiten, aber sicher effektiv arbeiten.
Antwort:
Gerne kann die Position als “wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in” besetzt werden. Wichtig ist, dass die genehmigte Fördersumme nicht überschritten wird und dass Sie bei der Berichtslegung kurz die Änderungen erwähnen.
Frage:
Aufgrund einiger Verzögerungen bei der Klärung interner (Verwaltungs-)Zuständigkeiten für das Aufbaumodul wäre die für Mai 2024 geplante Anstellung der Adminkraft erst mit einer Verzögerung um einen Monat mit Anfang Juni möglich. Wäre das aus Sicht des Fördergebers in Ordnung?
Antwort:
Ein Anstellungsbeginn ab 1.6.2024 ist möglich. Bitte beachten Sie, dass Kosten nur innerhalb der Laufzeit des Aufbaumoduls – bis Ende November 2026 - geltend gemacht werden können.
Frage:
Für die Maßnahmen im Rahmen des Aufbaumoduls wurden 2 Praedoc-Stellen angestellt. Eine der Stelle verlässt das Projekt und soll nun von einer Postdoc-Stelle ersetzt werden. Ist eine Anstellung mit geringerer Stundenzahl aufgrund des höheren Gehalts möglich?
Antwort:
Ja das Ersetzen einer Praedoc-Stelle durch eine Postdoc-Stelle ist möglich. Durch die höhere Einstufung wird eine Anpassung des Stundenausmaßes nötig. Wichtig ist, dass die Aufgaben gemäß Ihrer Antragstellung durchgeführt werden und die Projektumsetzung trotz Personaländerung weiterhin gewährleistet ist.
Personaländerungen, die sich im Laufe der Projektdurchführung ergeben sind im Zwischen- bzw. Endbericht bekanntzugeben und kurz zu erläutern.
Frage:
Die Umsetzung einer der geförderten Maßnahmen obliegt dem Projektpartner. Wenn das Budget komplett an die einreichende Institution (Haupt-Lead) überwiesen wird, wie soll das Budget für die einzelnen Maßnahmen an die Projektpartner weiter transferiert werden? Ist hierzu ein Kooperationsvertrag mit den Projektpartnern erwünscht/vonnöten oder soll vom ausführenden Projektpartner eine Rechnung gestellt werden? Gibt es hier Vorgaben?
Antwort:
Vom OeAD wird der gesamte Förderbetrag (in Raten) an die einreichende Institution ausgezahlt. Wie die Kooperation mit Projektpartnern geregelt wird, bleibt den Konsortien, gemäß den Vorgaben und Regelungen der jeweiligen Institution, überlassen. Wichtig ist ein Zahlungsausgang, entsprechend einem Vertrag, einer Honorarnote, einer Rechnung o.ä., an die Projektpartner, der im Rahmen der Verwendungsnachweise dokumentiert wird.
Frage: Einige Teilnehmende der Präsenz-Maßnahme haben ein Klimaticket. Kann hier der „erhöhten Beförderungszuschuss“ (RGV) als Grundlage für die Refundierung benutzt werden?
Antwort:
Für Dienstreisen mit dem Zug können Bedienstete, darunter fallen im Rahmen des Förderprogramms auch die Doktorand/innen, die ein privat erworbenes Klimaticket besitzen, den erhöhten Beförderungszuschuss gemäß § 7 Abs. 5 der Reisegebührenvorschrift (RGV) in Anspruch nehmen. Dieser Zuschuss ist für jene vorgesehen, die glaubhaft machen können, dass sie für die Reise Massenbeförderungsmittel genutzt haben. Das Klimaticket dient hierbei als Nachweis.
Die Höhe des erhöhten Beförderungszuschusses staffelt sich wie folgt:
- Für die ersten 50 Kilometer: 0,30 Euro pro Kilometer
- Für die nächsten 250 Kilometer: 0,15 Euro pro Kilometer
- Für jeden weiteren Kilometer: 0,08 Euro pro Kilometer
Der maximale Betrag des erhöhten Beförderungszuschusses beträgt 79,70 Euro pro Wegstrecke. Diese Regelung gilt seit dem 10. Oktober 2024. Ab dem 1. Januar 2025 wird gemäß dem Progressionsabgeltungsgesetz 2025 (PrAG 2025) ein Jahresdeckel für den Beförderungszuschuss eingeführt, der maximal 2.450 Euro pro Jahr beträgt.
Frage:
Können Reisekosten für Teilnehmer/innen einer Maßnahme im Rahmen des Aufbaumoduls pauschalisiert ausbezahlt werden?
Antwort:
Wie im Fördervertrag festgelegt, beruht die Förderung von Reisekosten auf der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, i. d. F BGBl. I Nr. 102/2018. Diese sieht eine pauschale Auszahlung erst bei regelmäßig wiederkehrenden Reisekosten (im Rahmen von Dienstreisen) vor. Daher ist es nicht möglich die Reisekosten pauschal zu erstatten. Bei der Auszahlung eines Reisekostenzuschusses muss darauf geachtet werden, dass dieser nicht höher als die tatsächlich anfallenden Reisekosten und in der Höhe maximal der Refundierung der RGV des Bundes gemäß den Richtlinien der Ausschreibung entspricht. Es darf nicht zu einer Überförderung kommen. Zur Dokumentation braucht es Belege und Bestätigungen der Auszahlungen.
Frage:
Eine externe Referentin muss mit dem Auto aus Deutschland anreisen. Aus den RGV wird eine maximale Kostenerstattung für Fahrten ohne ÖPNV von 52€ pro Strecke entnommen. Gilt dieses Limit auch für Externe bzw. Referent/innen? Oder gelten hier andere Bestimmungen?
Antwort:
In diesem Fall ist eine einmalige Vergütung der Reisekosten mittels amtl. Kilometergeld angebracht. Bitte begründen Sie die Notwendigkeit der Fahrt mit dem PKW bei Zwischen-/Endberichtslegung.
Ein Beförderungszuschuss kommt dann zu tragen, wenn man kein Ticket eines öffentl. Verkehrsmittel abrechnet und die Fahrt mit dem PKW nicht förderfähig ist.
Frage:
Können auch PH-Angehörige im Rahmen der Ausbildungskosten Teilnahmegebühren für zusätzliche Kurse, Tagungen, Seminare etc. refundiert bekommen oder können nur die Reisekosten erstattet werden? Wenn Kurskosten übernommen werden, wie wird dies formal gehandhabt, da an der PH nur Dienstreiseanträge gestellt werden können?
Antwort:
Mit den Ausbildungskosten (5000 Euro/Jahr/Doktorand/in) können auch Doktorand/innen einer PH Seminar-, Kurs- und Tagungskosten abrechnen. Wie dies formal an der jeweiligen PH gehandhabt wird, ist mit dem jeweiligen Rektorat bzw. mit den zuständigen Ansprechpersonen im BMB abzuklären.
Frage:
Können Kosten zwischen den einzelnen Kostenkategorien bzw. auch zwischen einzelnen Maßnahmen umgeschichtet werden?
Antwort:
Umschichtungen zwischen den Kostenkategorien (Personalkosten, Externe Dienstleistungen, Reisekosten, Material-/Sachkosten, Veranstaltungskosten, Sonstige Kosten) bzw. zwischen den Einzelmaßnahmen bedürfen Antragstellungen beim Fördergeber, wenn sie 15 % der Kosten überschreiten. Anträge dafür können und sollen im Rahmen des Zwischenberichts gestellt werden. Umschichtungen unter diesen 15% müssen nicht beantragt werden. Für die Nachvollziehbarkeit sollten alle Umschichtungen im Zwischen- bzw. Endbericht kurz erläutert und begründet werden.
Frage:
Worauf beziehen sich die 15% bei einer Kostenumschichtung? Auf die gesamte Fördersumme je Maßnahme oder auf die Summe des Kostenplanpunktes?
Antwort:
Die 15% beziehen sich auf die Kostenkategorie/Maßnahme bzw. wenn zwischen Maßnahmen umgeschichtet werden soll, dann 15% der Gesamtkosten. Bei Unsicherheiten können auch Umschichtungen unter 15% der Kosten mit dem Programmteam abgestimmt werden.
Auf jeden Fall sollten Umschichtungen im Zwischen- bzw. Endbericht erläutert und begründet werden.
Frage:
Da die Kosten im eingereichten Kostenplan zum Teil nur groben Richtwerten ermittelt werden konnte (z.B. bei Reise- und Nächtigungskosten etc.) und die tatsächlichen Kosten nun abweichen könnten, stellt sich die Frage ab welcher Änderungsgröße es eine Rücksprache mit dem Fördergeber bedarf?
Antwort:
Bei Differenzen zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten ist eine Rücksprache generell nicht notwendig. Wenn die tatsächlichen Kosten günstiger sind, wird eine geringere End-Rate ausbezahlt. Wenn insgesamt das Max.Budget beantragt wurde, muss bei Mehrkosten die Differenz selbst übernommen werden. Wenn ein Kostenpunkt günstiger und einer teurer als geplant ist, dann kann umgeschichtet werden. Hier gilt dann wieder die 15% Regelung.
BERICHTLEGUNG
Frage:
Wann müssen die Zwischenberichte abgeliefert werden?
Antwort:
Nach der Hälfte der Laufzeit (Juli 2025). Beim Zwischenbericht ist neben dem Sachbericht ebenfalls eine vorläufige Kostenaufstellung erforderlich. Vorlagen für den Kostenplan und den Zwischenbericht erhalten die Konsortien zeitgerecht vom Programmteam.
Frage:
Wann müssen die Endberichte abgeliefert werden?
Antwort:
Der Endbericht ist ein Monat nach Abschluss des Programms vorzulegen. Hier gilt die anberaumte Laufzeit des Förderprogramms. Dem Endbericht ist neben dem ausführlichen Sachbericht auch ein zahlenmäßiger Nachweis für die verwendeten Mittel zu erbringen. Eine Vorlage für den Endbericht und die Kostenabrechnung erhalten die Konsortien zeitgerecht vom Programmteam.
Frage:
Was muss im Endbericht behandelt werden?
Antwort:
Dem Endbericht ist neben dem ausführlichen Sachbericht ist auch ein zahlenmäßiger Nachweis für die verwendeten Mittel zu erbringen. Eine Vorlage für den Endbericht und die Kostenabrechnung erhalten die Konsortien zeitgerecht vom Programmteam.
- finale Kostenabrechnung:
Der zahlenmäßige Nachweis hat eine Aufgliederung aller mit der geförderten Leistung zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben zu umfassen (Gliederung analog des Kostenplanes im Antrag
Hat die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer von einem anderen Rechtsträger finanzielle Mittel erhalten, so hat der zahlenmäßige Nachweis auch diese zu umfassen.
Frage:
Wie erfolgt die Abnahme der Berichte?
Antwort:
Der Zwischenbericht wird wie der Startbericht von dem B3-Programm-Team des OeAD abgenommen.
Der Endbericht wird von externen Fachexpert/innen begutachtet. Neben der fachlich/inhaltlichen Evaluierung werden formale Rahmenbedingungen sowie Kosten vom OeAD geprüft.
Frage:
Sind die Belege aufzubewahren?
Antwort:
Die im zahlenmäßigen Nachweis angeführten Einnahmen und Ausgaben müssen durch Originalbelege nachweisbar sein, welche vom OeAD im Rahmen von Kontrollen auch angefordert werden können. Alle Belege sowie sonstige genannte Unterlagen sind – unter Vorbehalt einer Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch die ISB / den OeAD in begründeten Fällen – zehn Jahre ab dem Ende des Jahres der Auszahlung der gesamten Förderung, jedenfalls aber bis zur vollständigen Rückzahlung, mindestens jedoch ab der Durchführung der Leistung sicher und geordnet aufzubewahren.
PUBLIKATIONEN/DRUCKSORTEN IM RAHMEN DER PROGRAMME
Frage:
So wie üblich, würden wir gerne unsere Förderung bei den Publikationen erwähnen. Gibt es dazu bestimmte Vorgaben bzw. Wünsche Ihrerseits? Gibt es z.B. auch eine Projektnummer unseres Programms, die wir nennen sollen oder ähnliches?
Antwort:
Die Konsortiums-Partner/innen sind verpflichtet, alle Veröffentlichungen, die aus dem Projekt hervorgehen, mit folgendem Hinweis zu versehen: „finanziert und gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.“
Veröffentlichungen im Rahmen der Maßnahmen zum Aufbaumodul sind mit folgendem Hinweis zu versehen: „finanziert und gefördert aus Mitteln der Innovationsstiftung für Bildung in Österreich“.
Auf Informationsmaterialien sind die Logos des BMB und BMFWF, der ISB sowie des OeAD anzubringen.