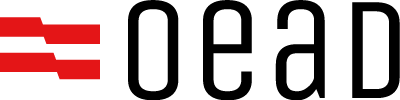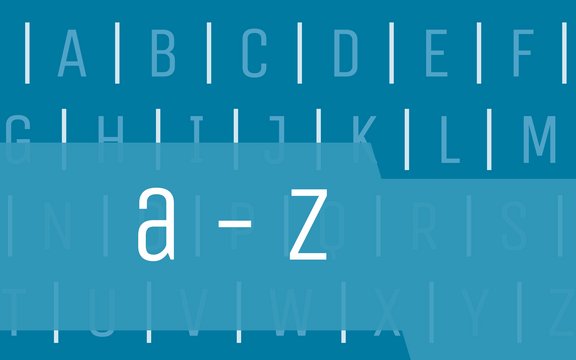ECTS:
ECTS steht für European Credit Transfer and Accumulation System. Durch den Bologna-Reformprozess wurde dieses Punkte-System eingeführt, um Studienleistungen in der EU vergleichbar, übertragbar und überall anrechenbar zu machen. Anstatt weiterhin in Semesterwochenstunden (SWS) zu rechnen, werden jetzt für erfolgreich abgeschlossene Veranstaltungen Leistungspunkte (Credits oder Credit Points) vergeben. Die Anzahl der Credit Points (CP) variiert je nach Aufwandshöhe der einzelnen Veranstaltungen. Ein Leistungspunkt entspricht dabei etwa 25 bis 30 Stunden Arbeit. Die Vergabe der Leistungspunkte ist nach ECTS am Arbeitsaufwand der Veranstaltung für die Studenten zu bemessen und nicht, wie bisher, an der tatsächlichen Präsenzzeit der Studenten in der Veranstaltung. In einem arbeitsintensiven Seminar mit viel Textlektüre, Prüfungsvorbereitung und Hausarbeit kann daher eine höhere Anzahl an Credit Points vergeben werden als in einer Veranstaltung, die dieselbe Präsenzzeit verlangt, aber kaum Arbeitsaufwand für die Studierenden bedeutet. Vor Einführung des ECTS wurde der Aufwand einer einzelnen Veranstaltung in Österreich lediglich mit Semesterwochenstunden berechnet. Eine Lehrveranstaltung entsprach dabei zwei Semesterwochenstunden, ungeachtet des Aufwandes, der zusätzlich anfiel.
E-Learning:
„E-Learning" (oder „eLearning“) ist seit langem als breiter Sammelbegriff im Einsatz und bezeichnete ursprünglich das Lernen mit jeglichen elektronischen Medien. In der aktuellen Praxis wird der Begriff vorrangig für Angebote des asynchronen Online-Lernens im Internet eingesetzt, kann aber als Sammelbegriff auch synchrone Angebote umfassen. Daher ist es empfehlenswert, das konkrete Begriffsverständnis durch Erläuterungen zu präzisieren, wenn „E-Learning" (oder „eLearning“) verwendet wird. Als Alternative bietet sich der breite Sammelbegriff des „technologiegestützten Lernens“ an - oder man spricht von „Online-Lernen“, um die synchronen und asynchronen Formen abzudecken und sie von klassischen Präsenzangeboten abzugrenzen.
Embracing Technology
Embracing Technology ist ein Förderprogramm der Innovationsstiftung für Bildung, in dem 20 Schulen mit Expert+ Status ausgewählt wurden, um in Zusammenarbeit mit eEducation Austria den Einsatz neuer Technologien im Unterricht und Schulalltag zu erproben. Ziel ist die Entwicklung und Sammlung praktischer Erfahrungen und innovativer Ansätze für den Bildungsbereich.
ENIC NARIC (AUSTRIA):
ENIC-NARIC ist zuständig für Fragen betreffend die Anerkennung von Studienabschlüssen ist das Nationale Informationszentrum für akademische Anerkennung. Es ist Teil der internationalen Netzwerke ENIC (European Network of Information Centres – gegründet von Europarat und UNESCO) und NARIC (National Academic Recognition Information Centres – gegründet von der Europäischen Union).
Entwicklungsforschung:
Entwicklungsforschung ist ein inter- und transdisziplinärer Wissenschaftsbereich. Auf Basis empirischer Studien werden entwicklungsrelevante Analysen und Problemlösungen für infrastrukturschwache und armutsbedrohte Länder, Gesellschaften und Regionen erarbeitet. Der thematische Rahmen und die entwicklungspolitischen Zielsetzungen der Entwicklungsforschung sind durch die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN-Sustainable-Development-Goals, SDGs) definiert. Forschungen in Kooperation zwischen österreichischen Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Partnerinstitutionen in Less und Least Developed Countries werden gefördert und begleitet, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der OeAD unterstützt in seiner Arbeit die Republik Österreich, den großen Herausforderungen und umfassenden Veränderungen der Zeit im Sinne des UN-Aktionsplanes „Transformation unserer Welt: Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ gerecht zu werden.
EPALE (E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa)
ist ein mehrsprachiger, virtueller Treffpunkt für alle, die in der Erwachsenenbildung tätig sind. Die EPALE-Plattform widmet sich unterschiedlichen Themenfeldern der allgemeinen, politischen und kulturellen Erwachsenenbildung sowie der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung.
EPALE Österreich ist Teil des europaweiten EPALE-Netzwerks, das aus 37 nationalen Koordinierungsstellen besteht. In Österreich wird EPALE vom OeAD – der Agentur für Bildung und Internationalisierung – als nationale Koordinierungsstelle koordiniert. Gemeinsam mit der zentralen Koordinierungsstelle befüllt EPALE Österreich die Plattform mit aktuellen Inhalten und Beiträgen und ist für die Qualitätssicherung sowie die Freischaltung von User-Beiträgen verantwortlich. Darüber hinaus organisiert EPALE Österreich regelmäßig Konferenzen, Workshops und Webinare, um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften der Erwachsenenbildung zu fördern. Dabei wird auch auf zentrale Tools der Plattform, wie die Projektpartnersuche oder den Erasmus+ Space, aufmerksam gemacht. Durch diese Aktivitäten trägt EPALE Österreich zur Vernetzung und Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung bei.
Erasmus+:
Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa. Erasmus+ bietet Mobilitäts- und Kooperationsmöglichkeiten in der Hochschulbildung, beruflichen Aus- und Weiterbildung, Schulbildung, (einschl. frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung), Erwachsenenbildung und Jugendarbeit. Erasmus+ unterstützt Prioritäten und Aktivitäten, die im europäischen Bildungsraum, dem Aktionsplan für digitale Bildung und der europäischen Kompetenzagenda festgelegt sind. Erasmus+ setzt die EU-Jugendstrategie 2019–2027 um und leistet einen Beitrag zur Umsetzung der Grundsätze für ein starkes soziales Europa, das gerecht und inklusiv ist und Chancen für alle bietet. Beteiligen können sich alle Akteure im Bildungs- und Jugendbereich: Junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, Studierende, Graduierte, Lehrkräfte und Personal, Schulen, Hochschulen, Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Erwachsenenbildung sowie aus dem Jugendbereich, Unternehmen, Sozialpartner, Behörden, Personalabteilungen, Bibliotheken, Gemeinnützige Organisationen oder Einrichtungen, Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs), europäische Jugend-NROs sowie informelle Gruppen junger Menschen und viele mehr. Die Fördermöglichkeiten inkludieren Berufspraktika, Studieren im Ausland sowie europaweite Fortbildungs- und Lehraufenthalte, Jugendbegegnungen und Fachkräftemobilitäten im Jugendbereich. Gefördert werden außerdem Projektpartnerschaften zwischen Institutionen. Der OeAD betreut als nationale Agentur den Bereich Erasmus+ in Österreich.
Erasmus+ (Berufsbildung):
Im Bereich Berufsbildung unterstützt Erasmus+ die länderübergreifende Zusammenarbeit von Berufsbildungseinrichtungen und anderer Organisationen mit Bezug zur beruflichen Bildung. Gefördert werden Mobilitäten von Schüler/innen in der beruflichen Erstausbildung, von Lehrlingen sowie von Lehr- und Fachkräften der beruflichen Bildung. Aufenthalte sind in ganz Europa sowie auch weltweit möglich. Zur Förderung von Exzellenz und Innovation in der beruflichen Bildung unterstützt Erasmus+ Zentren der beruflichen Exzellenz und Allianzen für Innovation sowie Kapazitätsaufbau.
Erasmus+ (Erwachsenenbildung)
Erasmus+ Erwachsenenbildung unterstützt Erwachsene, die im nicht-beruflichen Kontext lernen. Typische Themenfelder sind Demokratiebildung, Community Education, Basisbildung und die Anerkennung von informellen Kompetenzen.
Organisationen der allgemeinen Erwachsenenbildung können Erasmus+ auf mehrere Arten nutzen, z.B. im Rahmen von Mobilitätsprojekten fahren Personen zu Weiterbildungen in andere europäische Länder. Auch erwachsene Lernende können als Teilnehmer/innen an den Bildungsangeboten von Erwachsenenbildungsorganisationen partizipieren und mobil werden. In Partnerschaftsprojekten arbeiten mehrere Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung aus unterschiedlichen Ländern an gemeinsamen Zielen. Projektanträge können von Institutionen (nicht von Einzelpersonen) beim OeAD als nationale Agentur für die Umsetzung von Erasmus+ eingereicht werden.
Erasmus+ (Hochschulbildung):
Jahr für Jahr öffnet es über 7.500 Studierenden aus Österreich die Tür zu Hochschulen, Unternehmen und weiteren Organisationen im europäischen Ausland und darüber hinaus. Etwa 1.200 Lehrende und andere Angehörige österreichischer Hochschulen gehen jedes Jahr mit Erasmus+ ins Ausland. Zudem fördert Erasmus+ internationale Kooperationen zwischen Hochschulen sowie Projekte, die Hochschulen mit nicht akademischen Partnerorganisationen vorantreiben.
Erasmus+ (Kooperationspartnerschaften):
Erasmus+ Kooperationspartnerschaften widmen sich über einen längeren Zeitraum einem selbstgewählten Thema. Sie unterstützen Entwicklung, Transfer und Implementierung innovativer Praktiken ebenso wie gemeinsame Initiativen zur Förderung von Zusammenarbeit, Peer Learning und Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene. Möglich sind auch kleinere Partnerschaften mit kürzeren Laufzeiten, kleineren Förderbeträgen und geringerem Verwaltungsaufwand.
Erasmus+ (Mobilitätsprojekte):
Die Mobilität von Lernenden, Lehrenden, Personal, jungen Menschen und Fachkräften im Bereich Bildung und Jugend ist eine zentrale Aktivität von Erasmus+. Mobilitätsprojekte können von Einrichtungen im Bildungs- und Jugendbereich eingereicht werden.
Erasmus+ (Next Generation 2021 – 2027):
Erasmus+ ist das Förderprogramm der Europäischen Kommission für Bildung, Jugend und Sport. Grenzüberschreitende Mobilität für Menschen aller Altersgruppen, die Zusammenarbeit im Rahmen europäischer Projekte sowie die Unterstützung politischer Reformen sind die zentralen Aufgaben von Erasmus+. Das EU-Programm bietet Mobilitäts- und Kooperationsmöglichkeiten in der Hochschulbildung, beruflichen Aus- und Weiterbildung, Schulbildung (einschl. frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung), Erwachsenenbildung und Jugendarbeit.
Erasmus+ (Partnerschaften):
Partnerschaften für Zusammenarbeit umfassen Kooperationen zwischen Institutionen, die in den Bereichen Bildung und Jugend aktiv sind. Sie unterstützen die Internationalisierung im Bildungs- und Jugendbereich und fördern Innovationen in Bildung und Jugend. Einrichtungen sollen Erfahrungen mit internationaler Zusammenarbeit sammeln, ihre Kapazitäten stärken, innovative Ansätze entwickeln oder bewährte Verfahren austauschen.
Erasmus+ (Schulbildung):
Mit Erasmus+ Schulbildung unterstützt die Europäische Kommission grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Kindergärten, Schulen und anderen Institutionen mit Bezug zur Schule. Zudem bezuschusst das Programm Lehr- und Lernaufenthalte von (Vor-)schulpersonal im europäischen Ausland. Projektanträge können von Institutionen (nicht von Einzelpersonen) beim OeAD als nationale Agentur für die Umsetzung von Erasmus+ eingereicht werden.
ERINNERN:AT:
Mit seinem Programm ERINNERN:AT beschäftigt sich Österreichs Bildungsagentur OeAD mit dem Lehren und Lernen über Nationalsozialismus, Holocaust sowie der Prävention von Antisemitismus durch Bildung, umgesetzt im Auftrag des BMBWF. Die Arbeit von ERINNERN:AT gliedert sich in drei Ebenen:
Auf der regionalen Ebene arbeiten die dezentralen Netzwerke von ERINNERN:AT in den einzelnen Bundesländern. Die Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren sind niederschwellige Ansprechpartnerinnen bzw. -partner für Lehrkräfte und regionale Projekte der historisch-politischen Bildung.
Auf der nationalen Ebene bietet ERINNERN:AT vielfältige Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen und damit auch ein Diskussionsforum für eine aktive Erinnerung. Die von ERINNERN:AT entwickelten Lernmaterialien und auch die Jugendsachbuch-Reihe „Nationalsozialismus in den österreichischen Bundesländern“ werden in allen Bundesländern genutzt.
Auf der internationalen Ebene bietet ERINNERN:AT Seminare in Israel in Kooperation mit Yad Vashem an, ist durch Kooperationen mit internationalen Organisationen wie etwa der UNESCO, der OSZE und der IHRA deutlich sichtbar und arbeitet bilateral mit zahlreichen Partner-Institutionen zusammen. Einige der digitalen Lernmaterialien von ERINNERN:AT wurden mit internationalen Bildungspreisen geehrt und gelten als „best practice“.
Erstabschluss:
Abschluss eines Studiums, dessen Zulassung die Reifeprüfung einer höheren Schule oder eine vergleichbare Qualifikation erfordert. Demnach ist der Abschluss eines Bachelor- oder Diplomstudiums ein Erstabschluss. Der Abschluss eines Master- oder Doktoratsstudiums stellt einen weiteren Abschluss (Zweitabschluss) dar, da diese Studien als Zulassungsvoraussetzung einen Erstabschluss erfordern.
Erwachsenenbildung:
Unter Erwachsenenbildung versteht man grundsätzlich Bildungsangebote für Erwachsene; das Spektrum reicht von allgemeinbildenden Angeboten, der Basisbildung und dem Nachholen von Bildungsabschlüssen im Zweiten Bildungsweg über berufsbildende und persönlichkeitsbildende Angebote bis hin zu Hochschullehrgängen und universitärer Bildung. Erwachsenenbildung findet in den unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen und auch im Arbeitsfeld statt, es können sowohl formale als auch nicht-formale Abschlüsse erworben werden.
eTwinning:
Die Online-Plattform eTwinning ermöglicht Schulen grenzüberschreitende Online-Projekte und fördert die nationale und internationale Vernetzung von Pädagoginnen und Pädagogen mittels europäischer Fortbildungen und Konferenzen.
EURAXESS – Researchers in Motion:
EURAXESS – Researchers in Motion ist das Portal für Mobilität und Karriere in der Forschung. EURAXESS unterstützt die Mobilität und Karriere von Forscherinnen und Forschern und trägt somit zur Rolle Europas als Forschungsstandort bei. Neben einer Datenbank mit Jobangeboten, Stipendien und Förderungen bietet es Tools zur Karriereentwicklung sowie praktische Informationen für die Organisation eines Forschungsaufenthaltes im europäischen Forschungsraum. EURAXESS Austria ist Teil der Initiative und bietet Informationen zu einem Forschungsaufenthalt in Österreich. Der OeAD ist Netzwerkpartner und agiert gemeinsam mit der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) als österreichische Bridgehead-Organisation und Euraxess Centre.
EURAXESS Austria:
EURAXESS Austria ist Teil der europaweiten Initiative EURAXESS – Researchers in Motion und umfasst Maßnahmen zur Förderung der Mobilität und Karriereentwicklung von Forschenden. Aktuelle und umfassende Informationen zu einem Forschungsaufenthalt in Österreich bzw. über alle Fragen, die für die Mobilität von Forschenden wesentlich sind, werden auf EURAXESS Austria zur Verfügung gestellt. EURAXESS-Researchers in Motion umfasst folgende Bereiche:
Jobs & Funding EURAXESS beinhaltet Datenbanken mit Stellenangeboten und Fördermöglichkeiten für Forschende, Initiativen betreffend die Rechte und Aufgabenbereiche von Forschenden und ihren Arbeitgebern (Europäische Charta für Forscher & Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern) sowie Informationen und Ressourcen zur Karriereentwicklung von Forschenden
Information & Assistance EURAXESS unterstützt Forschende und deren Familien bei der Organisation des Aufenthalts und Fortführen ihrer Karriere in einem anderen Land
Partnering EURAXESS verbindet Einzelforschende und Organisationen und erleichtert Kollaboration
EURAXESS Worldwide ist ein Netzwerk für Forschende außerhalb Europas (Nordamerika, Japan, China, Indien, ASEAN - Association of South-East Asian Nations, LAC - Latin America and the Caribbean
Euroguidance:
Das Euroguidance-Zentrum Österreich ist die Schnittstelle zwischen der österreichischen und europäischen Bildungs- und Berufsberatung und bedient die Zielgruppe der Bildungs- und Berufsberater/innen in Österreich und Europa sowie Einzelpersonen, die sich über Lernmöglichkeiten und die Vielfalt der Informations-, Beratungs- und Orientierungsangebote für Beruf und Bildung informieren wollen. Dabei trägt das Zentrum zur Entwicklung der europäischen Dimension in der Bildungs- und Berufsberatung bei.
Europäischer Bildungsraum:
Die EU-Bildungszusammenarbeit hat das Ziel der Schaffung eines Europäischen Bildungsraums, in dem lernen und studieren, lehren und unterrichten, ausbilden und arbeiten grenzüberschreitend möglich ist. Dieser Europäische Bildungsraum soll auf mehreren Säulen beruhen:
auf der Annäherung der nationalen Bildungssysteme durch Transparenz, den Austausch von Erfahrungen und das Definieren gemeinsamer Ziele und Handlungsfelder auf politischer Ebene,
auf der Vergleichbarkeit von Qualifikationen und der gegenseitigen Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Lernzeiten bis hin zu gemeinsamen Abschlüssen (Joint Degrees) im Hochschulbereich,
auf der europaweiten strukturellen Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen und der transnationalen Mobilität von Einzelpersonen.
Die EU-Bildungszusammenarbeit setzt wichtige Impulse bei der Weiterentwicklung und Internationalisierung des österreichischen Bildungswesens. Die Errungenschaften der EU-Kooperation reichen von der Anerkennung beruflicher Qualifikationen (Berufsanerkennungsrichtlinie) über das ECTS-System bis hin zum Europäischen Qualifikationsrahmen. Als besonders richtungsweisend hat sich die immer engere und weit über die EU hinausgehende Kooperation der Nationalstaaten im Bologna-Prozess im Rahmen des Europäischen Hochschulraums erwiesen. Das wohl bekannteste und erfolgreichste Instrument der EU-Bildungszusammenarbeit ist das Bildungsprogramm Erasmus+. Im Gegensatz zu anderen Politikbereichen liegt Bildungspolitik allein in der Kompetenz der EU-Mitgliedstaaten. Die EU ist laut den Verträgen aber „für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig.“ (vergleiche Artikel 6 AEUV). Die strategischen Leitlinien und Bezugspunkte der Zusammenarbeit werden von den EU-Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat vorgegeben. Für den Bildungsbereich relevant sind die Europa 2020-Strategie, der strategische Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung („Education and Training 2030”; kurz „ET2030”) sowie die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14. Dezember 2017 zur sozialen Dimension, Bildung und Kultur. Die EU-Bildungszusammenarbeit ist stark von dem Prinzip des gegenseitigen Austauschs von Erfahrungen und der Verabschiedung von Empfehlungen und Schlussfolgerungen geprägt, mit dem die Mitgliedstaaten gemeinsame Herausforderungen, Handlungsfelder und Ziele definieren. Die Inhalte werden im EU-Bildungsausschuss von den Mitgliedstaaten verhandelt und von den EU-Bildungsministerinnen und EU-Bildungsministern im Rat der EU für Bildung, Jugend, Kultur und Sport beschlossen. Im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung setzen sich nationale Expertinnen und Experten in EU-Arbeitsgruppen (ET 2030) mit Fragestellungen der allgemeinen und beruflichen Bildung auseinander. Österreich gestaltet in diesen Arbeitsgruppen den Prozess auf europäischer Ebene aktiv mit. Ein wesentliches Instrument der EU-Bildungszusammenarbeit ist dabei die Entwicklung und Überprüfung von europäischen Benchmarks.
Europäischer Hochschulraum:
Seit 1999 werden in nunmehr 48 Ländern regelmäßig Bekenntnisse ausverhandelt, die den gemeinsamen Europäischen Hochschulraum (EHR) fördern. Diese Länder sind in der europäischen Bologna follow-up Group und in deren thematischen Arbeitsgruppen vertreten. Um den mittlerweile umfangreichen Bologna-Zielen schrittweise näher zu kommen, werden am Ende des Verhandlungszyklus, und somit alle drei Jahre, bei Ministeriellen Treffen gemeinsam neue Schwerpunkte festgelegt oder der Wille bekräftigt, gesetzte Ziele weiterhin zu verfolgen.
Europäischer Qualifikationsrahmen
Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) dient als Übersetzungsinstrument zwischen den Qualifikationsrahmen einzelner Länder und deren Qualifikationsniveaus. Der EQR trägt zur Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Qualifikationen bei. Es ist vorgesehen, dass nationale Qualifikationen nicht direkt dem EQR, sondern zunächst einem Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) zugeordnet werden. Jedes Land kann dabei die Struktur seines NQR selbst bestimmen, d. h. die Anzahl der Niveaus, die Definition der Deskriptoren und die Art und Anzahl der Dimensionen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz).
Europäisches Solidaritätskorps:
Das Europäische Solidaritätskorps fördert das Engagement junger Menschen in Projekten und Aktivitäten, die der Gemeinschaft zugutekommen. Das ESK bietet Jugendlichen (18 bis 30 Jahre) die Möglichkeit, sich in gemeinnützigen Projekten im eigenen Land oder im Ausland zu engagieren. Organisationen und Unternehmen können mit Hilfe des ESK junge engagierte Menschen für ihr Team gewinnen. Verschiedene Formate unterstützen die Verwirklichung von Projekten, die lokalen Gemeinschaften und Menschen in ganz Europa gleichermaßen zugutekommen.
Europass:
Der Europass bietet als europäisches Karrieremanagement-Portal kostenlose Online-Tools zur Unterstützung von Lernenden, Berufstätigen und Arbeitsuchenden. Für die Bewerbung und Karriereplanung bietet Europass unter anderem das Europass-Profil zur Beschreibung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten und den Europass Editor für Lebenslauf und Bewerbungsschreiben. Alle Tools stehen in 31 Sprachen zur Verfügung.
Evaluierung:
wird als Prozess verstanden, der Ziele und Maßnahmen auf ihre intendierte Wirksamkeit überprüft und als Grundlage für Verbesserung und Weiterentwicklung dient.
Externe Studierende Gemeinsamer Studien (FH):
Dies sind Studierende, die an einer beteiligten Partnerinstitution aufgenommen wurden und die festgelegten Semester des gemeinsamen Studienprogramms an der österreichischen FH absolvieren. Siehe > Gemeinsame Studien (FH) (Quelle: BMBWF Abteilung IV/7)
Extremismusprävention
Seit April 2022 werden mit der Initiative Extremismusprävention bundesweit Schüler/innen aller Schulstufen und Schultypen für die Gefahren von Ungleichheitsideologien sensibilisiert und ihre Resilienz gegenüber Radikalisierung gestärkt. Die Initiative bietet Reflexionsangebote für Fragen rund um Identität und Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft. Seit Herbst 2024 ist das Programm auch für Kursleiter/innen von AMS-Bildungsangeboten buchbar. Die Buchungsplattform wird vom OeAD umgesetzt.